- Grundlagen der medizinischen Untersuchung und Beweissicherung
- Screening für häusliche Gewalt
- Dokumentation bei häuslicher Gewalt
- Exkurs: Spezielle Aspekte bei der Dokumentation bei häuslicher Gewalt
- Einwilligung und Meldepflicht
- Medizinische forensische Dokumentation
- Körperliche Untersuchung
- Fotoaufnahmen
- Proben- und Beweismittelerhebung
- Rechtliche Aspekte
- Entlassung und Nachverfolgung
Im Blickpunkt: Gynäkologie/Geburtshilfe, Chirurgie und Pädiatrie - Gynäkologie/Geburtshilfe
- Notaufnahme
- Pädiatrie
Im Blickpunkt: Zahnheilkunde - Beweissicherung in der Zahnheilkunde
Quellen
Zielgruppe
In diesem Modul finden sich Lehrmaterialien für Trainer:innen, die in der Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitenden aus dem Gesundheitssektor sind, die beruflich mit Betroffenen von häuslicher Gewalt zu tun haben. Das Modul wurde ausschließlich für Professionelle in diesem Bereich konzipiert und ist nicht an Betroffene häuslicher Gewalt oder ihr unmittelbares soziales Umfeld gerichtet.
Kurzer Überblick über Modul 4
Modul 4 bietet einen Überblick über die medizinische Untersuchung und Beweissicherung. Es wird darauf eingegangen, wie gesicherte oder vermutete Fälle häuslicher Gewalt dokumentiert und medizinische Untersuchungen respektvoll durchgeführt werden können sowie welche rechtlichen und ethischen Aspekte berücksichtigt werden sollten.
Folgende Ziele können Sie als Trainer:in mithilfe des Moduls 4 verfolgen:
+ Ein vertieftes Wissen von Kursteilnehmenden über die sachgerechte und gerichtsverwertbare Dokumentation von Verletzungen im Kontext häuslicher Gewalt unter Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben.
+ Eine klare Orientierung in den zentralen Aspekten und Handlungsschritten, die nach der Offenlegung häuslicher Gewalt durch Patient:innen zu beachten sind.
Allgemeine Leitprinzipien für die Behandlung von Patienten oder Patientinnen mit bestätigter oder vermuteter Gewalt: 1
1. Behandeln Sie die Patienten und Patientinnen mit Würde, Respekt, Mitgefühl und mit Sensibilität für Alter, Kultur, ethnische Zugehörigkeit und sexuelle Orientierung. Machen Sie immer klar, dass häusliche Gewalt in jeder Beziehung inakzeptabel ist.
2. Fragen Sie in der Anamnese nach häufigen Wechseln von behandelnden Ärzt:innen (sogenanntes “Doctor-Hopping“), da dies ein Indikator für häusliche Gewalt sein kann.
3. Erkennen Sie an, dass der Prozess sich aus einer gewalttätigen Beziehung zu befreien oft langwierig und durch mehrere Zyklen von Trennungen und Versöhnungen gekennzeichnet ist.
4. Versuchen Sie die Betroffenen längerfristig in das Gesundheitssystem einzubinden, um sie dabei zu unterstützen, mehr Sicherheit und Kontrolle über ihr Leben zu erlangen.
5. Die Sicherheit der Betroffenen und ihrer Kinder hat Vorrang.
6. Von häuslicher Gewalt betroffene Personen sollten niemals gedrängt werden, über die erlebte Gewalt zu sprechen, wenn sie dies nicht möchten. Die Fragen sollten sich in jedem Fall auf das beschränken, was für die medizinische Versorgung notwendig ist.
In Fällen von schweren Verletzungen: „ …der Schwerpunkt sollte in erster Linie auf der Versorgung von Verletzungen liegen, die Beweissicherung kommt erst danach“.2
1. Grundlagen der medizinischen Untersuchung und Beweissicherung
Nach der Aufdeckung von häuslicher Gewalt müssen folgende Aspekte berücksichtigt werden:
- Eine umfassende Anamnese ist erforderlich. Dabei sollte die übliche Vorgehensweise bei der Anamneseerhebung eingehalten werden. Es ist wichtig zu beachten, dass von Gewalt Betroffene häufig traumatisiert sind. Vorhandene medizinische Berichte sollten gründlich geprüft werden, und es sollte vermieden werden, bereits beantwortete Fragen erneut zu stellen.
- Jeder Teil der Untersuchung sollte erklärt werden und eine entsprechende informierte Einwilligung eingeholt werden.
- Informieren Sie die Betroffenen darüber, dass die Sicherung von Beweisen einen wichtigen Beitrag zum Gerichtsverfahren leisten kann, wenn die Person sich entschließen sollte, Anzeige zu erstatten.
- Gewaltbetroffene die Beweise sichern möchten, können sich an spezialisierte Einrichtungen wie eine Gewaltschutzambulanz wenden. Diese können die Beweissicherung übernehmen.
- Es sollte eine gründliche körperliche Untersuchung durchgeführt werden. Befunde und Beobachtungen sollten mit Hilfe von forensischen Befundbögen klar und übersichtlich festgehalten werden.
- Die Befunde in der Krankenakte sollten in den eigenen Worten der Patientin/des Patienten dokumentiert werden. Falls dies notwendig erscheint, sollten zusätzliche Fragen gestellt werden.
Überweisen Sie Patientinnen und Patienten mit lebensbedrohlichen oder schweren Erkrankungen sofort in die Notaufnahme eines Krankenhauses.

Wie kann eine medizinische Untersuchung respektvoll durchgeführt werden?
- Verringern Sie den Machtunterschied (setzen Sie sich z. B. auf einen niedrigen Hocker).
- Gewähren Sie der Patientin/dem Patienten Kontrolle und Wahlmöglichkeiten – teilen Sie ihnen mit, dass sie die Untersuchung jederzeit abbrechen können, wenn gewünscht.
- Holen Sie die Erlaubnis der Patientin/des Patienten ein und informieren Sie sie/ihn über den nächsten Schritt.
- Fragen Sie, ob es Bereiche gibt, wie beispielsweise die Brust oder das Becken, deren Untersuchung für die Patientin/den Patienten besonders unangenehm ist. Erkundigen Sie sich, was getan werden kann, um die Untersuchung angenehmer zu gestalten.
- Erklären Sie alles genau und ermutigen Sie dazu, Fragen zu stellen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Ausmaß der Anspannung.
- Halten Sie gegebenenfalls Blickkontakt (sofern kulturell angemessen).
- Erinnern Sie die Patientin/den Patienten daran, warum die Untersuchung durchgeführt wird, und erläutern Sie die Vorteile.
- Nehmen Sie sich ausreichend Zeit.
Aspekte der mentalen Gesundheit
Bei vielen Betroffenen von häuslicher Gewalt können emotionale und/oder psychische Probleme auftreten. Sobald die Gewalt oder der Missbrauch vorüber ist, können sich emotionale Folgen bessern. Einige Betroffene sind jedoch schwerer traumatisiert als andere. Es ist wichtig, dies zu erkennen und mit Betroffenen traumasensibel zu kommunizieren und sie entsprechend zu behandeln. Darauf spezialisierte Beratungsstellen, Psychotherapeut:innen und/oder Trauma-ambulanzen können Hilfe und Techniken anbieten, um den Stress von Betroffenen zu verringern und die Heilung zu fördern.
- Stellen Sie eine Überweisung an eine Psychotherapeutin/einen Psychotherapeuten oder an lokale spezialisierte Beratungsstellen/Traumaambulanzen aus, wobei mögliche Probleme wie lange Wartelisten berücksichtigen werden sollten.
Begleitpersonen

Wenn die Patientin/der Patient von einer Person begleitet wird, die möglicherweise für die Gewalt verantwortlich ist oder eine enge Beziehung zum Täter/der Täterin hat, lassen Sie sie nicht in den Untersuchungsraum mitkommen.3
Bei der Anamneseerhebung und der Untersuchung müssen Ärzt:innen sicherstellen, dass die Patientin/der Patient die Möglichkeit hat, allein oder mit einer selbst gewählten Begleitperson mit der Ärztin/dem Arzt zu sprechen. Falls die Patientin/der Patient eine Erwachsenenvertretung hat, sollte es ihr/ihm überlassen sein zu entscheiden, wer sie/ihn während der Untersuchung begleitet. Der Arzt/die Ärztin sollte zunächst der Patientin/dem Patienten ein vertrauliches Gespräch anbieten. Familienmitglieder, Freund:innen und Betreuende können potenzielle Risiken darstellen, da sie beispielsweise den Täter/die Täterin über den Inhalt von Gesprächen informieren könnten.4
Bild von Freepik
Sprachbarrieren
Wenn die Patientin/der Patient Ihre Sprache nicht oder nur unzureichend spricht, sorgen Sie für eine professionelle Sprachvermittlung. Familienmitglieder sind für diese Aufgabe ungeeignet. 5
Vermeidung von Wartezeiten
Vermeiden Sie Wartezeiten, insbesondere für Betroffene von sexueller Gewalt und für Personen, die einen Angriff auf den Hals (Strangulation) erlebt haben.6
2. Screening auf häusliche Gewalt 7
Ein Screening auf häusliche Gewalt erweist sich insbesondere dann als effektiv, wenn ein zuverlässiges Screening-Instrument in einem privaten und persönlichen Rahmen eingesetzt wird. Die Einbeziehung des Screenings auf häusliche Gewalt als Routineelement in die Patient:innengespräche ermöglicht es den Ärzten und Ärztinnen, häusliche Gewalt im Rahmen der Gesundheitsversorgung zu thematisieren.
Sie könnten Folgendes sagen:
Weitere Informationen zur Kommunikation finden Sie in Modul 3. In Modul 2 finden Sie sowohl allgemeine Gewaltindikatoren als auch spezifische Indikatoren für Gynäkologie/Geburtshilfe, Chirurgie (Notaufnahme) und Pädiatrie.
Bei Menschen mit Behinderungen sollte das Screening erweitert werden, um neben häuslicher Gewalt auch den möglichen Missbrauch durch einen persönliche/n Betreuer:in zu erfassen. Leider werden Menschen mit Behinderungen bei der Untersuchung auf Missbrauch häufig übersehen. Eine Studie ergab, dass zwar 90 % der Frauen mit verschiedenen Behinderungen in ihrem Leben Gewalt erlebt hatten (68 % davon im letzten Jahr), aber nur 15 % von einem Gesundheitsdienstleister jemals nach Missbrauch befragt worden waren.8 Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Menschen mit Behinderungen allein untersucht werden, bevor eine persönliche Pflegekraft oder ein Intimpartner/eine Intimpartnerin zur Unterstützung bei der Kommunikation oder Mobilität hinzugezogen werden.
Achten Sie unbedingt auf Anzeichen früherer Gewalt und andere Gesundheitsstörungen!
3. Dokumentation bei häuslicher Gewalt
Bevor Sie mit der Dokumentation beginnen, klären Sie stets im Voraus, ob ein sexueller Übergriff vorliegt und ob die Beweissicherung im Mittelpunkt der Dokumentation steht. Treffen Sie dementsprechend die Entscheidung, welches der Formulare Sie auswählen werden. Weiterführende Informationen zur Dokumentation eines sexuellen Übergriffs finden Sie hier.

Schriftliche Dokumentation
„Meine Anwältin sagten, dass es einfach nicht genug Beweise in meiner Krankenakte gebe. Nichts würde darauf hindeuten, dass mein Ex die Schuld an meinen Verletzungen trug. Ich war so enttäuscht. Ich dachte, mein Arzt hätte alles aufgeschrieben, was ich damals gesagt habe.“

Expertinneninterview mit Daniela Dörfler zu Modul 4: Medizinische Untersuchung und Beweissicherung
Ass. Prof.in OÄin Dr.in med. Daniela Dörfler ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Sie leitet die Opferschutzgruppe (OSG) des Allgemeinen Krankenhauses (AKH) der Stadt Wien. Die Opferschutzgruppe wurde gemäß § 15d Wiener Krankenanstaltengesetz, „Früherkennung von Gewalt“, 2009 eingerichtet. (Deren Etablierung ist seit 1. Januar 2009 in Zentral- und Schwerpunktkrankenhäusern vorgeschrieben.) Mitglieder der OSG sind ärztliche Vertreterinnen/Vertreter der Frauenheilkunde, der Unfallmedizin und der Psychiatrie, des Pflegedienstes sowie der psychologischen oder psychotherapeutischen Versorgung. Ausführliche Informationen zu Opferschutzgruppen: https://toolbox-opferschutz.at/Opferschutzgruppen. Gerade die Ambulanzen der Krankenhäuser sind oft die erste Anlaufstelle von gewaltbetroffenen Personen und bilden somit eine wesentliche Schnittstelle zu Beratungseinrichtungen. Die OSG bietet einen wichtigen Beitrag zur Früherkennung und Frühintervention bei Gewaltopfern. Weitere Aufgaben sind die Beratung des ärztlichen und des Pflegedienstes bei Verdacht bzw. Vorliegen von Anzeichen von sexueller, körperlicher und psychischer Gewalt, deren Sensibilisierung für Gewalt, das Erstellen von Dokumenten zum strukturierten Vorgehen bei Fragen des Opferschutzes, die Organisation von internen Fortbildungen sowie die Spurensicherung und interdisziplinäre Zusammenarbeit.
In dem folgenden Interview beantwortet Ass. Prof.in OÄin Dr.in med. Daniela Dörfler die Fragen, was bei der Sicherung von Beweismitteln sowie im Umgang mit Betroffenen von häuslicher Gewalt während der Spurensicherung zu beachten ist.
Hier geht es zum Video: https://training.improdova.eu/wp-content/uploads/2021/08/DD_Modul_4.mp4
Dokumentationsbogen und Kit zur Spurensicherungsset verwenden
Nutzen Sie für die Dokumentation von Verletzungen und die Sicherung von Spuren stets einen Dokumentationsvordruck und ein Spurensicherungs-Kit. Sie werden damit Schritt für Schritt durch die Untersuchung geleitet und bei einem systematischen Vorgehen unterstützt.9

Quelle: https://www.praxisleitfaden-gewalt.de/index.php/downloadbereich
Auf den folgenden Seiten finden Sie weitere Dokumentationsbögen, die Sie im Alltag nutzen können:
- Ärztlicher Befundbericht für Opfer nach sexualisierter Gewalt
- Dokumentationsbogen mit Körperschemata A3 Format
- Dokumentationsbogen mit Körperschemata A4 Format
- Dokumentationsbogen Formular für Onlinebearbeitung
- Ärztliche Dokumentation nach häuslicher Gewalt – körperlicher Misshandlung
- Formulierungshilfe für die gerichtsfeste Befunddokumentation – PD. Dr. med. H. Graß
- Dokumentation und Untersuchung bei sexualisierter Gewalt
Verletzungen
Beschreiben Sie jede Verletzung in den Dimensionen: Lokalisation, Form/Grenze, Größe, Farbe, Typ. Wenn möglich, verwenden Sie eine Tabelle zur Beschreibung der Befunde. Zeichnen Sie jede Verletzung in eine Körperkarte ein. So erhalten Sie einen Überblick über die Lage und ggf. eine Konzentration der Verletzungen am Körper.
Weitere relevante Information:
- Welche Formulare wurden ausgefüllt, um Verletzungen zu dokumentieren?
- Welche Laboruntersuchungen/Röntgenaufnahmen wurden angeordnet?
- Welcher Bericht wurde angefordert oder wurde eingereicht?
- Name des untersuchenden Arztes/der untersuchenden Ärztin und welche weiteren Maßnahmen ergriffen wurden
Für Laien verständlich formulieren
Ihre Dokumentation wird in erster Linie von nicht medizinisch ausgebildeten Personen wie Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen, Polizei, Justiz und Behörden genutzt. Dokumentieren Sie für diese Berufsgruppen verständlich und lesbar. Verzichten Sie auf Abkürzungen und medizinische Fachbegriffe.
Erst dokumentieren, dann versorgen
Dokumentieren Sie Verletzungen, wenn möglich, vor Ihrer medizinischen Versorgung. Hat die Behandlung Vorrang, prüfen Sie, ob eine fotografische Dokumentation der unversorgten Verletzung(en) möglich ist. Geht es um sexuelle Gewalt, denken Sie daran, Material (z. B. Kleidung), das DNA-Spuren der gewaltausübenden Person enthalten könnte, aufzubewahren.
- Dokumentieren Sie Ihre Einschätzung der Situation (psychiatrisch, in Bezug auf die Sicherheit von Gewalt betroffenen Personen, Vorliegen von Gewalt gegen Kinder oder Ältere)
- Dokumentieren Sie alle Überweisungen (Sozialdienste, Hotlines, psychische Gesundheit, Rechtshilfe, Polizei)
- Dokumentieren Sie die besprochenen weiteren Schritte, z. B. Erstellung eines Sicherheitsplans
Beachten Sie, dass eine psychiatrische Diagnose in einem Sorgerechtsstreit vor Gericht gegen die Patientin/den Patienten verwendet werden kann. Stellen Sie sicher, dass Sie den Zusammenhang zwischen dem Missbrauch und den psychiatrischen Symptomen, sowie die Bemühungen des von Gewalt betroffener Person, sich selbst und ihre Kinder zu schützen und zu versorgen, angeben.
Beschreiben, nicht interpretieren10
Dokumentieren Sie rein deskriptiv! Verzichten Sie auf eine Interpretation von Befunden wie z. B. auf die Einschätzung des Wundalters oder auf die Beurteilung, ob eine Verletzung durch Fremdeinwirkung entstanden ist.
- Verwenden Sie neutrale Sprache – formulieren sie „die Patientin/der Patient gibt an“ anstatt „die Patientin/der Patient behauptet“.
- Kennzeichnen Sie die eigenen Worte der Patientin/des Patienten mit Anführungszeichen.
- Beschreiben Sie die Situation im Detail – wer, was, wann, wo, wie (Drohungen? Verletzungen durch Waffen oder Gegenstände? Zeug:innen?).
- Beschreiben Sie andere Vorfälle/Muster von Missbrauch, Drohungen.
- Beschreiben Sie die Folgen für die körperliche und geistige Gesundheit.
Verletzungen fotografieren
Fotos sind besonders aussagestark und können die schriftliche Dokumentation ergänzen. Verletzungen im vaginalen oder analen Bereich sollten Sie nur bei eindeutigen Befunden fotografieren.
Spuren sichern
Eine Spurensicherung erfolgt in aller Regel nur im Zusammenhang mit sexueller Gewalt. Die Durchführung übernimmt soweit möglich der Facharzt oder die Fachärztin, der bzw. die auch die medizinische Versorgung leistet. Für weibliche Betroffene sollte eine Gynäkologin zur Verfügung stehen, für männliche ein Urologe, Abdominalchirurg oder Unfallchirurg (bzw. chirurgischer Dienst).
Weiterführende Maßnahmen
- Einen sicheren Weg zur Kontaktaufnahme mit den von Gewalt Betroffenen einrichten
- Vereinbaren Sie Folgetermine
Hier sind einige Beispiele für schriftliche Dokumentation: 11
| Vermeiden Sie juristische Ausdrücke, die Zweifel an Ihrem Glauben an die Betroffenen aufkommen lassen könnten | Verwenden Sie objektive und beschreibende Begriffe |
|---|---|
| Patientin behauptet, ihre Pflegerin habe sie mit einem Lockenstab verbrannt. | Die Patientin gibt an, dass ihre Pflegerin Susi ihr den Lockenstab aus der Hand gerissen und gegen ihren Hals gehalten hat. |
| Die Patientin bestreitet, dass ihre Pflegerin sie verbrannt hat, und behauptet, sie habe sich selbst verbrannt. | Der körperliche Befund einer Verbrennung stimmt in Größe und Form mit dem Bericht überein, dass diese durch einen Lockenstab verursacht wurde. Schweregrad und Lokalisierung der Verbrennung scheinen nicht mit dem Bericht der Patientin übereinzustimmen, dass sie sich selbst verbrannt hat. |
| Patientin wurde hysterisch, als sie den Vorfall beschrieb. | Die Patientin weinte und zitterte unkontrolliert, als sie den Vorfall beschrieb. |
Zusammenfassend sollte Ihre Dokumentation in Bezug zu der erlebten Gewalt folgendes umfassen: 12
- Die Antworten von Patient:innen auf die Fragen des Screenings und kleine, aber relevante Details, wenn mehr Informationen mitgeteilt werden.
- Ihre objektiven Beobachtungen von Aussehen, Verhalten und Auftreten der Patientin/des Patienten.
- Erfassung aller neueren und älteren Verletzungen mit detaillierter Beschreibung, wobei alle relevanten negativen Befunde ebenfalls festzuhalten sind.
- Ihr Behandlungsplan, Ihre Empfehlungen für die medizinische Nachsorge und etwaige Überweisungen an weitere Fachstellen wie z. B. Beratungszentren.
- Erwägung, ob Aufzeichnungen im Rahmen der Ausnahmeregelung zur Schadensverhütung zurückgehalten werden sollten, wobei die Patientin/der Patient darauf hinzuweisen ist, dass sie/er auch beantragen kann, dass Aufzeichnungen im Rahmen der Ausnahmeregelung zum Schutz der Privatsphäre zurückgehalten werden.
- Dokumentation von etwaigen Einschränkungen bei der Untersuchung (Beleuchtung, Zusammenarbeit usw.).
- Die von Gewalt betroffene Person sollte darauf hingewiesen werden, dass bestimmte Verletzungen in den folgenden Tagen deutlicher sichtbar werden können. In solchen Fällen sollte eine weitere Untersuchung und Dokumentation empfohlen werden. 13
Denken Sie daran: Als medizinisches Fachpersonal gehört es nicht zu Ihren Aufgaben, die Ursache von Verletzungen zu ermitteln, unabhängig davon, ob es sich um Missbrauch, Selbstverteidigung oder eine andere Ursache handelt. Durch eine gründliche Untersuchung und eine genaue Dokumentation der Aussagen des Patienten/der Patientin und der klinischen Befunde können Sie jedoch ein medizinisches Protokoll erstellen, das in Zukunft als wertvoller juristischer Beweis für etwaige Gewalttaten dienen kann.
Vergessen Sie nie: „Die Sicherheit der betroffenen Person hat höchste Priorität“
World Health Organization (WHO), 2015 14
Wesentliche Inhalte der Dokumentation
Rahmendaten
Erforderlich sind Angaben zur Patientin bzw. zum Patienten, zur untersuchenden Person, zu weiteren anwesenden Personen inkl. Sprachmittlern und Sprachmittlerinnen sowie Angaben zu Ort und Uhrzeit der Untersuchung.
Anamnestische Angaben
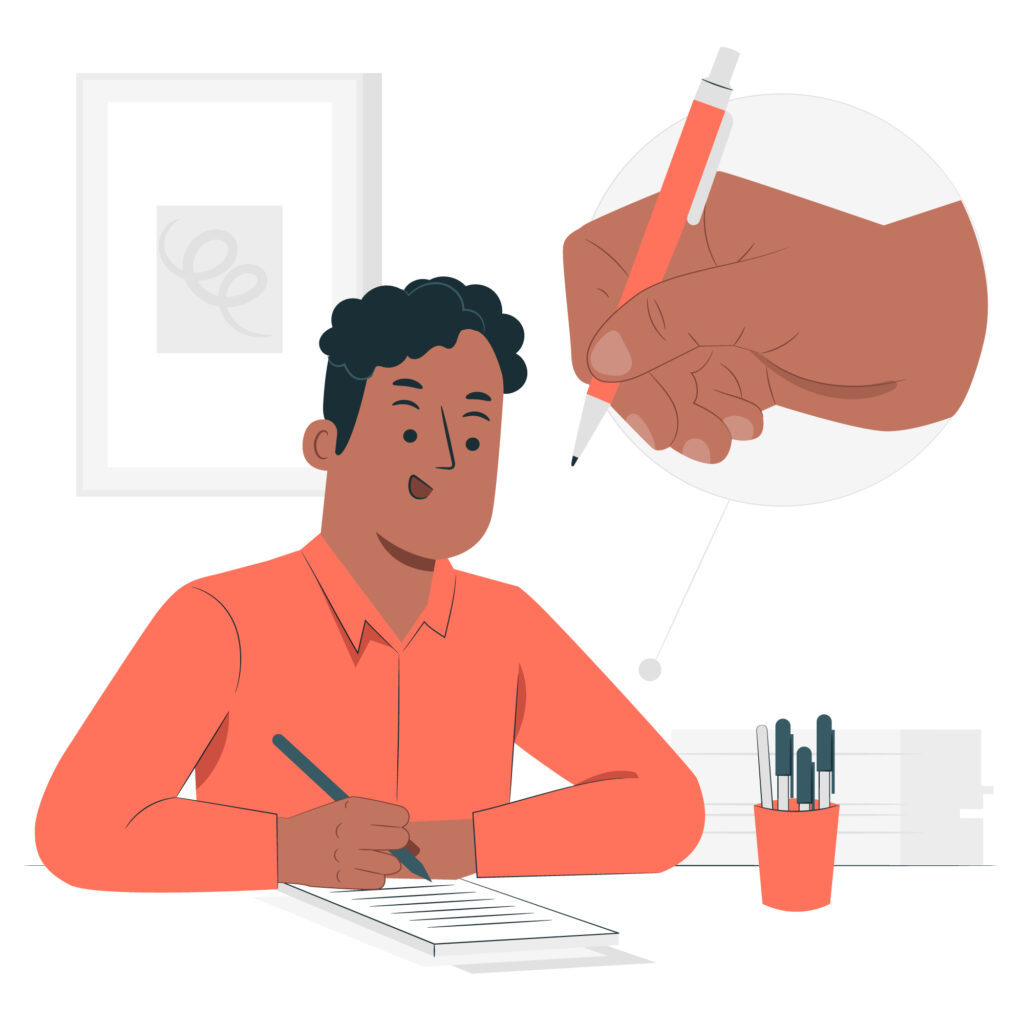
Bild von storyset auf Freepik
Notieren Sie anamnestische Angaben nur soweit, wie sie für das Verletzungsgeschehen von Bedeutung sind. Wesentlich sind Informationen zum Datum, zum ungefähren Zeitpunkt und zum Ort des Übergriffs, zu ggf. eingesetzten Tatwerkzeugen, zu beteiligten oder anwesenden Personen, zur Zustands-/Bewusstseinslage der Patientin/des Patienten bei der Untersuchung sowie kurze Angaben zum Ereignisablauf (was ist wann, wo, wie, durch wen erfolgt). Wenn Sie neben dem Dokumentationsbogen ein zusätzliches Blatt nutzen, beschriften Sie es wie den Dokumentationsbogen mit Datum, Uhrzeit, Patient:innendaten. Notieren Sie Angaben zum Ereignis in wörtlicher Rede. Sie machen damit kenntlich, dass es sich um Angaben der verletzten Person und nicht um Ihre Interpretation handelt. Geben Sie an, wer Angaben gemacht hat, falls es nicht die Patientin/der Patient selbst war.
Befunderhebung
Orientieren Sie sich an den Vorgaben des genutzten Dokumentationsbogens. Dokumentieren Sie sowohl positive als auch negative Befunde. Wenn Sie eine Körperregion nicht untersucht haben, notieren Sie dies und vermerken Sie den Grund – z. B. „Patient:in lehnt dies ab“. Grundsätzlich ist eine Ganzkörperuntersuchung zu empfehlen.
Angriff gegen den Hals
Von besonderer Dringlichkeit ist eine Untersuchung bei Verdacht des Angriffs gegen den Hals (Würgen/Drosseln). Strafrechtlich kann es sich ggf. um eine versuchte Tötung handeln. Verletzungsbilder, die hierauf einen Hinweis geben, verschwinden zum Teil rasch. Dokumentieren Sie stets: Stauungsblutungen (Petechien) in den Lid- und Bindehäuten, der Mundschleimhaut oder der Hinterohrregion (relevante Verminderung des Blutabflusses); vorübergehende Bewusstlosigkeit; Wahrnehmungsstörungen (sog. Aura), Kontrollverlust über die Ausscheidungsorgane, Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und Globusgefühl.
4. Exkurs: Spezielle Aspekte bei der Dokumentation von sexueller Gewalt
Die Einwilligung zur Durchführung der Untersuchung ist von der verletzten Person oder ihrem Vormund einzuholen. Die Einwilligung sollte sich auf jeden Untersuchungsschritt (insbesondere die Genitaluntersuchung), auf die Freigabe von Befunden und Proben sowie auf etwaige Fotografien beziehen. Die betroffene Person kann in einige Aspekte einwilligen, in andere nicht. Die Einwilligung kann jederzeit zurückgezogen werden und sollte durch Unterschrift oder Fingerabdruck dokumentiert werden.
- Das äußere Erscheinungsbild und das Verhalten der betroffenen Person (Auftreten, mentaler Zustand, eventueller Drogenkonsum, Kooperation während der Untersuchung) sollten dokumentiert werden. Gleichfalls ist die Identität der zu untersuchenden Person sowie das Datum, die Uhrzeit und der Ort der Untersuchung zu vermerken.
- Alle Einschränkungen der Untersuchung (z. B. Beleuchtung, Kooperation usw.) sollten ebenfalls dokumentiert werden.
- Es ist ratsam, eine gründliche Untersuchung durchzuführen, die sich an der vorherigen Anamnese orientiert. Sowohl die untersuchten als auch die nicht untersuchten Bereiche sollten detailliert dokumentiert werden.
- Alle neueren und älteren Verletzungen sollten erfasst und detailliert beschrieben werden. Auch alle negativen Befunde sind zu dokumentieren.
- Die Betroffenen sollten darüber informiert werden, dass einige Verletzungen erst nach einigen Tagen stärker sichtbar werden könnten und dass sie in diesem Fall zur Untersuchung und Dokumentation wiederkommen sollten.
- Es sollten alle entnommenen Proben, durchgeführten Fotografien, angeordneten diagnostischen Tests oder eingeleiteten Behandlungen vermerkt werden.
- Die von Gewalt betroffene Person sollte eine ausführliche Erläuterung der Befunde, der Behandlung und der Folgemaßnahmen erhalten.
Besondere Maßnahmen sollten ergriffen werden, wenn die von Gewalt betroffene Person minderjährig ist. Weitere Informationen dazu finden Sie weiter hinten im Blickpunkt Pädiatrie.
Anzeige bei der Polizei
Die forensische Dokumentation und Spurensicherung nach sexueller Gewalt können mit oder ohne Anzeige der Patientin/des Patienten erfolgen. Klären Sie, ob diese/dieser eine Anzeige erstattet hat oder erstatten möchte. Achten Sie auf den Zeitrahmen für die Beweissicherung und die zum Zeitpunkt der Untersuchung verfügbaren Informationen. Bei einer von der Patientin/dem Patienten in Auftrag gegebenen Dokumentation oder vertraulichen Beweissicherung werden die Unterlagen aufbewahrt und nur auf Anfrage, z. B. bei einer späteren Anzeige, an die Polizei ausgehändigt. Eine schriftliche Entbindung von der Schweigepflicht und die Zustimmung zur Herausgabe der Unterlagen ist immer erforderlich.
Medizinische Untersuchung und Beweissicherung
Den von Gewalt betroffenen Personen sollten alle Schritte sorgfältig erklärt werden. Dazu gehören die Gründe für die vorgeschlagene Untersuchung und deren Umfang, alle Verfahren, die möglicherweise durchgeführt werden, die Entnahme von Proben und das Fotografieren. Jede Genital- oder Analuntersuchung muss einfühlsam und genau erklärt werden.15 Tragen Sie sterile chirurgische Handschuhe, um eine Kontamination, z. B. von DNA-Spuren mit Ihrer eigenen DNA, zu vermeiden. Halten Sie Aqua destillata in kleinen Verpackungen bereit. Nehmen Sie für jeden vorgesehenen Untersuchungsschritt die in Ihrem Dokumentationsblatt aufgeführten Abstriche. Arbeiten Sie nur mit selbsttrocknenden Tupfern. Entscheiden Sie anhand der Angaben der Patientin/des Patienten, wo die Abstriche entnommen werden sollen. Wenn die Patientin/der Patient keine Angaben machen kann, müssen Sie unbedingt eine vollständige Spurensicherung durchführen (wie im Dokumentationsbogen angegeben).
- Proben für die toxikologische Untersuchung: Grundsätzlich empfiehlt sich die Entnahme einer Blut- und Urinprobe zum Nachweis oder Ausschluss einer kürzlichen Einnahme von Betäubungsmitteln, Drogen oder Alkohol. Falls erforderlich, kann zusätzlich eine Haarprobe – frühestens vier Wochen nach der angegebenen Einnahme von Drogen – sichergestellt werden.
- Bei unerklärlicher Bewusstlosigkeit oder Gedächtnislücken ist die Möglichkeit einer unwissentlichen Einnahme von Drogen in Betracht zu ziehen.
- Kleidung: Sichern Sie Kleidung, die zur Tatzeit getragen wurde – sie könnte DNA-Spuren des Täters/der Täterin enthalten. Verpacken Sie die Kleidung in einzelne Papiersäcke. Verschließen Sie die Tüten und beschriften Sie sie zur späteren Identifizierung mit dem Namen und dem Datum der Patientin/des Patienten.
- Genitale oder anogenitale Untersuchung: Die Harnblase sollte erst nach der Untersuchung entleert werden. Untersuchen Sie zuerst die äußeren Genitalien und den Perianalbereich auf Verletzungen und Fremdkörper (bevor Sie das Spekulum einführen).
- Vaginale Untersuchung: Wenn keine vaginale Penetration stattgefunden hat, ist eine vaginale Untersuchung nicht erforderlich. Sie sollte jedoch immer angeboten werden. Untersuchen Sie die Vagina und den Gebärmutterhals auf Verletzungen und Fremdkörper.
- Untersuchung der männlichen Genitalien: Untersuchen Sie Penis und Hoden auf Verletzungen, wobei Sie besonders auf Bissverletzungen am Penis oder Blutergüsse an den Hoden achten sollten.
- Anale Untersuchung: Die Inspektion des Anus erfolgt am besten in Seitenlage mit angezogenen Beinen. Besteht der Verdacht auf eine Verletzung des Enddarms oder der Analöffnung, sollte eine proktologische Untersuchung durchgeführt werden.
Medizinische Behandlung
Klären Sie, ob eine Notfallverhütung notwendig/gewünscht ist. Wägen Sie gemeinsam mit der Patientin/dem Patienten das Risiko einer HIV-Infektion oder einer anderen sexuell übertragbaren Krankheit ab und gehen Sie nach den aktuellen fachlichen Standards vor. Falls erforderlich, sollten Sie die Patientin/den Patienten an eine Einrichtung zur HIV-Beratung und/oder HIV-Postexpositionsprophylaxe (PEP) überweisen (Vorsicht: Falls indiziert, muss die HIV-PEP so schnell wie möglich bzw. innerhalb von 72 Stunden begonnen werden).
Dokumentation
Alle an der Bearbeitung von Fällen sexueller Gewalt beteiligten Parteien sollten sich der Beweise bewusst sein, die möglicherweise erhoben werden oder eine Auswertung erfordern. Zu den Zielen der Beweiserhebung können gehören: der Nachweis einer sexuellen Gewalttat und ihres Kontexts, das Herstellen einer Verbindung zwischen dem Angreifer/der Angreiferin und der betroffenen Person, die Verknüpfung von Fakten und Personen mit dem Tatort und die Identifizierung des Täters/der Täterin.
Wesentliche Punkte 16
- Die körperliche Untersuchung wird in erster Linie durchgeführt, um gesundheitliche Probleme zu klären. Wenn sie innerhalb von fünf Tagen nach dem Übergriff erfolgt, kann es sinnvoll sein, forensische Proben zu entnehmen. Alle Untersuchungen müssen dokumentiert werden.
- Penetrierende sexuelle Handlungen in der Vagina, am Anus oder im Mund führen selten zu objektiven Anzeichen einer Verletzung. Das Jungfernhäutchen kann auch nach der Penetration nicht verletzt erscheinen. Daher schließt das Fehlen einer Verletzung eine Penetration nicht aus. Der Arzt/die Ärztin kann sich daher nicht dazu äußern, ob die Aktivität einvernehmlich war oder nicht.
- Es gibt unterschiedliche Zwecke und Verfahren für die Entnahme von Proben für medizinische (Pathologie) und rechtliche (Forensik) Untersuchungen. Pathologische Proben werden analysiert, um eine Diagnose zu stellen und/oder einen Zustand zu überwachen. Forensische Proben werden verwendet, um festzustellen, ob eine Straftat begangen wurde und ob es eine Verbindung zwischen Personen und/oder Orten gibt. Pathologische Proben können von erheblicher forensischer Bedeutung sein, insbesondere wenn eine sexuell übertragbare Infektion festgestellt wird.
- Das forensische Labor benötigt Informationen über die Probe (Uhrzeit, Datum, Patient:innenname/ID-Nummer, Art und Ort der Entnahme) und darüber, wonach gesucht wird.
- Forensische Proben: Die Schilderung des Übergriffs bestimmt, ob und welche Proben entnommen werden. Im Zweifelsfall sollten sie immer entnommen werden. Die Persistenz von biologischem Material ist unterschiedlich. Sie wird durch Zeit, Aktivitäten (Waschen) und Kontamination aus anderen Quellen beeinflusst. Das maximale Zeitintervall (Zeitpunkt des Angriffs bis zum Zeitpunkt der Entnahme) für die Routineentnahme ist:
- Haut einschließlich Bisswunden: 72 Stunden
- Mund: 12 Stunden
- Vagina: bis zu 5 Tage
- Anus: 48 Stunden
- Fremdmaterial auf Gegenständen (Kondom/Bekleidung): keine zeitliche Begrenzung
- Urin (Toxikologie) 50 mL: bis zu 5 Tage
- Blut (Toxikologie) 2 × 5 mL Proben: bis zu 48 Stunden in Röhrchen mit Natriumfluorid und Kaliumoxalat.
- Haare: abgeschnittenes Kopfhaar kann nützlich sein, wenn der Verdacht einer verdeckten Verabreichung von Drogen besteht.
- In allen Fällen ist eine sorgfältige Kennzeichnung, Lagerung und Aufzeichnung der Überwachungskette erforderlich.
- Die Proben sollten nicht in Kulturmedien aufbewahrt werden und vor dem Verpacken trocken sein.
- Kleidung (insbesondere Unterwäsche) und toxikologische Proben sollten bei Bedarf entnommen werden.
- Fotografien sind eine nützliche Ergänzung zur Dokumentation von Verletzungen. Fragen der Einwilligung, des Zugangs (unter Wahrung der Privatsphäre und der Vertraulichkeit) und der Sensibilität (insbesondere bei Genitalfotos) müssen mit den betroffenen Personen geklärt und vereinbart werden.
- Sexuelle Gewalt sollte bei einer Autopsie berücksichtigt werden. In diesen Fällen sollten Dokumentation und Probenentnahme erfolgen.
- Wenn ein sexueller Übergriff zu einer Schwangerschaft führt, sollte die Entnahme von Proben für einen Vaterschaftstest in Betracht gezogen werden.
5. Einwilligung und Meldepflicht

Einwilligung
Die Einwilligung zur Durchführung der Untersuchung ist von der betroffenen Person bzw. bei Kindern von der obsorgeberechtigten Person einzuholen. Die Einwilligung sollte sich auf jedes Verfahren (insbesondere die Genitaluntersuchung), auf die Freigabe von Befunden und Proben sowie auf etwaige Fotografien beziehen. Die betroffene Person kann in einige Aspekte einwilligen, in andere nicht, und die Einwilligung kann zurückgezogen werden. Sie sollte durch Unterschrift oder Fingerabdruck dokumentiert werden.17

Vertraulichkeit18
Die gerichtsmedizinische Untersuchung unterliegt der ärztlichen Verschwiegenheitspflicht.
Weitere Information
- Die Patientin/der Patient sollte eine Erklärung darüber erhalten, wie ihre/seine Gesundheitsinformationen verwendet, weitergegeben und offengelegt werden, einschließlich einer Information über die Grenzen der Vertraulichkeit(Anzeigepflicht bei schweren Körperverletzungen).
- Die Patientin/der Patient sollte über ihre/seine Rechte auf Zugang, Berichtigung, Änderung und Ergänzung der eigenen Gesundheitsinformationen aufgeklärt werden.
- Persönliche und sensible Gesundheitsinformationen sollten, wann immer möglich, pseudonymisiert werden.
- Der behandelnde Arzt/die behandelnde Ärztin muss Patient:innen die Wahl lassen, ob sie bevorzugt von einem Arzt oder Ärztin untersucht werden möchten, und diese Präferenz respektieren.
- Datenschutzbestimmungen und Einwilligungen sollten den Daten folgen, und der Arzt/die Ärztin sollte deutlich auf Einschränkungen der Einwilligungen hinweisen, wenn Gesundheitsdaten an einen anderen Anbieter weitergegeben werden der möglicherweise nicht die gleichen Datenschutzeinstellungen haben.
- Der Arzt/die Ärztin sollten einen weiten Ermessensspielraum haben, um Informationen zurückzuhalten, wenn die Offenlegung dem Patienten schaden könnte.
6. Medizinische forensische Dokumentation
Die klinische forensische Untersuchung
Im Rahmen des EU-Projektes „Rights of Victims of Survived Bodily Harm and Improved Access to Clinical Forensic Examinations (RiVi)“ entwickelte das Institut für Rechts- und Verkehrsmedizin des Universitätsklinikums Heidelberg ein Online-Training zur klinisch-forensischen Untersuchung. Es richtet sich insbesondere an Ärzt:innen, Pflegekräfte, aber auch an Berufsgruppen, die von Gewalt betroffene Menschen betreuen und unterstützen, wie z. B. Mitarbeiterinnen von Gewaltschutzzentren, Opferschutzeinrichtungen, Polizei, Richter:innen, etc.
Eine umfassende Untersuchung und forensische Dokumentation der körperlichen Verletzungen sowie die Sicherung etwaiger Spuren sexueller Gewalt sind ein wesentlicher Bestandteil der Erstversorgung.
- Die forensische Dokumentation geht über die normale medizinische Dokumentation hinaus. Sie ist von großer Bedeutung für die strafrechtliche Verfolgung der Tat(en) und kann betroffene Personen z. B. bei der Klärung von Umgangs- und Sorgerechtsfragen oder bei aufenthaltsrechtlichen Fragen maßgeblich unterstützen.
- Die ärztliche Befunddokumentation ist oft der einzige Beweis dafür, dass davon betroffene Personen körperliche häusliche Gewalt erlebt haben, insbesondere dann, wenn sie die Tat später anzeigen wollen.
- Auch für Ärzte/Ärztinnen,die die Betroffenen untersuchen, ist eine sorgfältige Dokumentation wichtig, da sie eine wertvolle Grundlage für eine eventuelle spätere Zeugenaussage darstellt.
- Die Dokumentation, die vor Gericht verwendet werden kann, muss vertraulich sein.
Die VIPROM Med.DocCard© fasst die wichtigsten Aspekte einer medizinischen Intervention bei häuslicher Gewalt zusammen und beschreibt, was zu tun ist. Sie fasst die gerichtsfeste Dokumentation von Verletzungen zusammen. Die Karte hilft auch bei der Dokumentation der Größe von Verletzungen (z. B. mittels der Skala auf dieser Karte).

Die Karte kann hier heruntergeladen, mit einer Größe von 99 x 204 mm ausgedruckt und vor Gebrauch laminiert werden (1 cm auf der Karte entspricht dann 1 cm in der tatsächlichen Größe).
7. Körperliche Untersuchung
Personen, die von Gewalt betroffen sind, benötigen eine sorgfältige Untersuchung, bei der die Vorgeschichte des aktuellen Übergriffs sowie andere relevante gesundheitliche Probleme berücksichtigt werden. Zum Beispiel müssen Ärzte und Ärztinnen bei körperlichen und radiologischen Untersuchungen auf Anzeichen früherer Gewalt oder unbehandelter Verletzungen achten, besonders wenn der Zugang zu Medikamenten aufgrund von Gewalt eingeschränkt ist.20
Eine umfassende Untersuchung sollte Folgendes umfassen:21
- “Physical assessment as dictated by the patient’s presenting complaint
- Körperliche Untersuchung entsprechend den vorliegenden Beschwerden der betroffenen Person
- Allgemeines Erscheinungsbild, Verhalten, Kognition und mentaler Zustand der Betroffenen
- Untersuchung der Körperoberflächen und der Mundhöhle auf körperliche Befunde
- Zusätzliche Tests, einschließlich Laboruntersuchungen und Bildgebung
- Beurteilung der Gewaltbereitschaft des Täters/der Täterin (akut und langfristig)
- Spezielle Beurteilungen je nach Anamnese (z. B. Beurteilung von Strangulationen)
- Überprüfung wie sich die Gewalt nach Ansicht der betroffenen Person auf ihre/seine Gesundheit ausgewirkt hatWurden Hilfsmittel wie z. B. Rollstühlen beschädigt
- Aktuelle Sicherheitsbedenken und -bedürfnisseSicherheit von Kindern/Missbrauch von Kindern/Zeugenschaft von Kindern (falls zutreffend) oder anderen vulnerablen Haushaltsmitgliedern
- Einschätzung der Gefährlichkeit des Täters/der Täterin und eine Risikobewertung für zukünftige Anwendung von Gewalt.
Strangulation
Unter Strangulation versteht man die Blockierung der Blutgefäße und/oder der Luftzufuhr im Halsbereich durch äußere Kompression, was zum Ersticken führt. Sie ist eine häufige Verletzungsmethode bei häuslicher Gewalt. Daher ist es für Kliniker:innen von entscheidender Bedeutung, eine umfassende Beurteilung von Patient:innen vorzunehmen, die von einer Strangulation betroffen waren.22
Körperliche Untersuchung: 23
- Ist die Patientin schwanger?
- Liegt ein abnormaler Karotispuls vor?
- Sind Petechien vorhanden? (Hinweis: Bei einigen Arten von Asphyxie, z. B. Erstickung, können Petechien auch außerhalb von Kopf und Hals auftreten).
- Gesicht / Ohren (einschließlich Gehörgänge) / Nasengänge / Augen / Bindehaut / Mundhöhle / Kopfhaut / Sonstige (genau beschreiben)
- Welchen Umfang hat der Hals der Patientin/des Patienten?
- Liegt eine Verletzung der Zunge vor?
- Liegt eine Verletzung der Mundhöhle vor?
- Liegt eine subkonjunktivale Blutung vor?
- Ist bei der Manipulation des Krikoid-Knorpels eine Krepitation (als sicheres Frakturzeichen) zu hören?
- Liegt eine sichtbare Verletzung vor?
- Gibt es Ausfälle der Hirnnerven?
8. Fotoaufnahmen24
Fotos können sehr hilfreich für die medizinische Dokumentation von Verletzungen sowie für die Erfassung von Schäden an der Kleidung oder anderen Gegenständen der Patientin/des Patienten (z. B. Hilfsmittel oder Mobilitätshilfen) sein. Lehnt eine Patientin/ein Patient jedoch die Aufnahme von Fotos ab oder verfügt eine Einrichtung nicht über eine Kameraausrüstung, kann der Arzt/die Ärztin dennoch eine umfassende medizinisch-forensische Untersuchung durchführen, die sich auf eine narrative Dokumentation und das Ausfüllen eines Dokumentationsbogens stützt. Medizinisch-forensische Untersuchungen sind mehr als eine fotografische Auflistung von Verletzungen.
Für manche Patient:innen kann das Fotografieren traumatisch sein. Bevor im Rahmen einer gerichtsmedizinischen Untersuchung fotografiert wird, ist es wichtig, ein umfassendes Einverständnis einzuholen, in dem auch die Besonderheiten der Fotografie besprochen werden, z. B. die verwendete Ausrüstung, die Speicherung, die Weitergabe und der Zugang zu den Bildern. Das Einverständnis oder die Zustimmung der Patientin/des Patienten sollte unmittelbar vor der Aufnahme von Fotos nochmals bestätigt werden, wobei die Aufnahme zu jedem Zeitpunkt der Untersuchung abgelehnt werden kann.
Wichtige Punkte: 25
- Nehmen Sie Fotografien von Verletzungen diskret auf. Achten Sie dabei auf die Vertraulichkeit. Fotografieren Sie die Brust und die Genitalien nur, wenn es offensichtliche Verletzungen in diesen Bereichen gibt.
- Stellen Sie sicher, dass die Anonymität der Fotos gewahrt bleibt und die Person nicht direkt identifiziert werden kann.
- Führen Sie ein vertrauliches Codesystem ein, das es autorisierten Personen ermöglicht, die Person zu identifizieren und den Zeitpunkt der Fotoaufnahme festzuhalten.
Fotografische Dokumentation von Verletzungen
Verwenden Sie eine Digitalkamera mit den richtigen Einstellungen, einschließlich einer Skala für die Proportionen (vorzugsweise ein Winkellineal). Notieren Sie für jedes Bild das Datum und den Namen der Patientin/des Patienten.
Machen Sie mindestens zwei Fotos pro Verletzung: ein Übersichtsfoto zur Lokalisierung und ein Detailfoto mit Maßstab und, falls erforderlich, einer Farbtafel. Nehmen Sie die Bilder im rechten Winkel zur Verletzung auf und stellen Sie sicher, dass die Skala direkt auf die Verletzung gehalten wird. Verwenden Sie einen neutralen Hintergrund und eine gute indirekte Beleuchtung.
Überprüfen Sie die Anzeige auf Klarheit und Vollständigkeit. Machen Sie zusätzliche Fotos, wenn Sie unsicher sind. Bewahren Sie alle Fotos sicher auf (fallbezogene Speicherkarte, passwortgeschützter Ordner), löschen Sie sie dann aus der Kamera oder formatieren Sie die SD-Karte neu.
Sensible Körperregionen nur fotografieren, wenn eindeutige Befunde vorliegen, vollständige Aufnahmen von Genitalien vermeiden. Geben Sie ausgedruckte Fotos diskret in einem Umschlag weiter.

9. Proben- und Beweismittelerhebung
Überlegungen zum Umgang mit Proben/Beweisen: 26
- Der behandelnde Arzt/die behandelnde Ärztin sollte während des gesamten Trocknungsprozesses von Beweisen bis zur ordnungsgemäßen Verpackung, Versiegelung und Übergabe an die Strafverfolgungsbehörden die Kontrolle über alle Proben/Beweise behalten.
- Die Übergabe der Proben/Beweise vom behandelnden Arzt/ von der behandelnden Ärztin an die Strafverfolgungsbehörden sollte dokumentiert werden, um eine ordnungsgemäße Handhabung und Übergabe innerhalb der Beweiskette, insbesondere für eine mögliche spätere rechtliche Verwendung, nachweisen zu können.
- Erläuterungen zur routinemäßigen Probenentnahme sowie Formulare für die Beweiskette verfügen, können das entsprechende Formular von der zuständigen Strafverfolgungsbehörde erhalten. Nach der Zusammenstellung aller Proben/Beweise sollte eine Kopie angefertigt werden, die zusammen mit der Krankenakte aufbewahrt wird.
- Wenn Hilfsmittel von Patient:innen während des Angriffs beschädigt wurden, dokumentieren Sie dies und machen Sie, wenn möglich, Fotos. Wenn die Geräte repariert oder ersetzt wurden, dokumentieren Sie den Schaden in der gerichtsmedizinischen Akte.
- In Fällen von Strangulation, die zum Verlust der Kontrolle über die Blase/den Darm führt, sammeln Sie mit dem Einverständnis der Patientin/des Patienten die Unterwäsche und/oder die nächste Kleidungsschicht ein. Diese Kleidungsstücke sollten einzeln in Papiertüten verpackt werden, und wenn sie nicht vollständig getrocknet sind, sollten die Strafverfolgungsbehörden bei der Übergabe darüber informiert werden, dass eine zusätzliche Trocknungszeit erforderlich ist.
- Die Proben-/Beweismittelentnahme kann mit der körperlichen Untersuchung zusammenfallen, aber die Patient:innen können dies ablehnen, und es sollte betont werden, dass dies ihr Recht ist und dadurch ihre medizinische Behandlung nicht beeinträchtigt wird.
10. Rechtliche Aspekte
Ärztinnen und Ärzte unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht! Verweigert ein erwachsener Patient oder eine erwachsene Patientin die Informationsweitergabe, ist dieser Wunsch nach Privatsphäre zu respektieren! Es gibt jedoch Ausnahmen…
Wann ist Schweigen nicht mehr „Gold“?27
…bei Erwachsenen:
- nach § 34 – Rechtfertigender Notstand: schwere körperliche Misshandlungen mit Wiederholungsgefahr können das Durchbrechen der Schweigepflicht nach sorgfältiger Abwägung der Gesamtumstände rechtfertigen
- nach §138 – Nichtanzeige geplanter Straftaten, z.B. bei Androhung schwerwiegender Gewalt: Meldung bei den Behörden, keine Meldung bei vergangenen Taten
…bei Kindern und Jugendlichen:
- 2021 wurde eine Änderung des Kinder- und Jugendschutzgesetzes erlassen, die nun auch Zahnärztinnen und Zahnärzte dazu befugt im Falle einer Kindeswohlgefährdung das Jugendamt zu informieren.

Bild von Freepik
Wenn es Anzeichen gibt, dass das Wohl von einem Kind/Jugendlichen gefährdet ist: 28

Adaptiert nach S3-Leitlinie Kindesmisshandlung, -missbrauch, -vernachlässigung unter Einbindung der Jugendhilfe und Pädagogik (Kinderschutzleitlinie), Kitteltaschenkarte „Vorgehen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung“
Download Kitteltaschenkarte der AWMF bei Vorgehen bei Bekanntwerden von gewichtigen Anhaltspunkten für Kindeswohlgefährdung.
…bei einer schriftlichen Schweigepflichtsentbindung (durch den Betroffenen oder die Betroffene/ Sorgeberechtigte):
- bei Kindern bis zum vollendeten 14. Lebensjahr: Sorgeberechtigte müssen Ärztin/ Arzt von Schweigepflicht entbinden.
- bei Jugendlichen über 14 Jahren – wenn sie die erforderliche Reife besitzen, die Tragweite der Handlung zu überblicken, dürfen diese Zahnärzte/Zahnärztinnen selbst von der Schweigepflicht entbinden.
- Antworten auf polizeiliche Anfragen oder Aussagen vor Gericht sind nur dann zulässig, wenn entweder eine Schweigepflichtsentbindung oder eine gesetzliche Offenbarungspflicht vorliegt – sonst Zeugnisverweigerungsrecht nach §53 Absatz 1 Nr.3 Strafprozessordnung.
… in Bezug auf ärztliche Unterlagen und Befunde:
- unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht, Herausgabe an Dritte nur bei Beachtung der oben aufgeführten Punkte
- nur Kopien herausgeben, Originale immer behalten
11. Entlassung und Nachverfolgung

Geben Sie der Patientin/dem Patienten eine Kopie des Dokumentationsbogens und Fotos, falls gewünscht, mit. Sprechen Sie Sicherheitsfragen bezüglich der Aufbewahrung an (Zugang durch Täter:in?). Weisen Sie darauf hin, dass sie/er die Kopie so lange aufbewahren und verwenden kann, wie sie/möchte.
Erkundigen Sie sich nach dem Sicherheits- und Schutzbedürfnis der Patientin/des Patienten und ggf. ihrer/seiner Kinder. Wenn es Hinweise auf eine mögliche Gefährdung gibt und die Patientin/der Patient nicht nach Hause zurückkehren möchte, überweisen Sie sie an Schutzeinrichtungen wie z. B. Frauenhäuser. Weitere Informationen zur Risikobewertung finden Sie in Modul 5.
Informieren Sie die Patientin/den Patienten über psychosoziale Beratungsdienste zur Bewältigung von Gewalt. Helfen Sie bei der Kontaktaufnahme, vereinbaren Sie einen Termin bei einer spezialisierten Beratungsstelle und stellen Sie schriftliche Informationen zur Bewältigung des Erlebnisses zur Verfügung. Sprechen Sie mögliche Folgen für Kinder an, falls diese betroffen sind, und weisen Sie auf verfügbare Unterstützungsdienste hin. Befolgen Sie die Klinikregeln für Kinderschutzfälle. Besprechen Sie notwendige medizinische Nachsorgemaßnahmen, bieten Sie einen Termin an oder vereinbaren Sie einen solchen, und legen Sie gegebenenfalls ein ärztliches Attest vor.
Quelle: adaptiert nach Recommendations for forensic documentation and securing evidence after domestic and sexual violence for medical practices and hospitals in Berlin
Im Blickpunkt: Gynäkologie/Geburtshilfe, Chirurgie und Pädiatrie
12. Gynäkologie/Geburtshilfe
Eine gynäkologische Untersuchung nach einer Vergewaltigung/einem sexuellen Übergriff kann für die meisten Personen eine emotionale Herausforderung darstellen. Es ist von großer Bedeutung, Betroffene so bald wie möglich nach dem Vorfall zu untersuchen. Idealerweise sollten sie von einer vertrauten Person begleitet werden. Diese Untersuchung ist wichtig, um mögliche Verletzungen zu erkennen, zu behandeln und Beweise zu sichern, unabhängig davon, ob eine Strafanzeige bei der Polizei erfolgt.
Wenn die Untersuchung auch der Spurensicherung dient, ist es entscheidend, dass die Spurensichernde Person (Ärztin/Arzt/Pflegekraft/Hebamme) sich umfassend über das Geschehene informiert. Die betroffenen Personen sollten darauf aufmerksam gemacht werden, dass die ärztliche Untersuchung auch die Sicherung forensischer Beweise beinhaltet. Weitere Informationen finden Sie im Exkurs zu speziellen Aspekten der Dokumentation sexueller Gewalt.
13. Chirurgie: Notaufnahme
In der Notaufnahme sollte das Screening auf häusliche Gewalt bei einer Triage mit Vorsicht angegangen werden, da die Privatsphäre eingeschränkt ist und die Screening-Fragen mitgehört werden können.
Körperliche Untersuchung bei Fällen von häuslicher Gewalt
Die Verletzungen sollten sorgfältig bewertet und in der Krankenakte vermerkt werden:
- Allgemeiner Zustand: Ernährung, Flüssigkeitszufuhr; emotionaler und psychologischer Zustand der betroffenen Person
- Beschreibung der Art der Verletzungen: Narben, Prellungen, Abschürfungen, Exkoriationen, Hämatome, Risswunden, Verbrennungen; abgebrochene oder ausgeschlagene Zähne; Riss des Trommelfells (in der Regel einseitig und aufgrund eines heftigen Schlags)
- Morphologie der Verletzungen mit Bezug darauf, wie sie entstanden sind: Beißen, Schneiden, manueller Griff, Einschnürung, Auspeitschen, Verbrennungen/Verätzungen (z. B. durch Zigaretten)
- Lokalisierung der Verletzungen an für unfallbedingte Verletzungen untypischen Stellen: Kopf und Gesicht, Augen, Nase, Mund, Handrücken und -flächen, Nägel, Brustkorb, hinterer Genitalbereich oder Perianalbereich, Knöchel
- Anzahl der Läsionen: z. B. Auftreten zahlreicher Läsionen oder Vernarbungen derselben (manchmal sind die Läsionen so zahlreich, dass ihre Beschreibung als „Kartenläsionen“ bezeichnet wird)
- Zeitliche Chronologie: Läsionen in verschiedenen Entwicklungsstadien (gleichzeitiges Vorhandensein von Frakturen und Knochenschwielen, Narben, ständige Blutungen oder unter Schorf, Ekchymosen und Hämatome mit unterschiedlicher Farbentwicklung)
- Bei körperlicher Misshandlung während der Schwangerschaft muss eine gynäkologisch-geburtshilfliche Untersuchung durchgeführt werden, um den Gesundheitszustand der Frau und des Fötus zu beurteilen
 | Warnsignal für ein hohes Femizid-Risiko: Wenn Frauen im Gesicht, am Mund, am Kopf und am Hals (die als identitätsstiftende Bereiche angesehen werden können) sowie an den Brüsten, am Schambein und an den Gliedmaßen (d. h. an den sexuellen Bereichen) geschlagen werden, könnte dies ein Hinweis auf künftige Femizide sein. 30 |
Fallstudie – Verletzungen in der Notaufnahme
Sara, eine 36-jährige Frau, kommt in die Notaufnahme, um sich wegen einer Kopfverletzung behandeln zu lassen. Die untersuchende Ärztin stellt nicht nur die Kopfverletzung fest, sondern auch mehrere Hämatome an Saras linkem Arm (siehe untere Abbildung) und weitere Blutergüsse in verschiedenen Stadien der Heilung.
Sara wird von ihrem Bruder begleitet, der während der medizinischen Untersuchung eine kontrollierende Rolle übernimmt, Fragen in ihrem Namen beantwortet und die Interaktion zwischen Sara und der Ärztin genau beobachtet. Sara vermeidet den Blickkontakt und gibt von sich aus nur ungern Informationen preis.
Als die Ärztin Sara untersucht, wird deutlich, dass die Erzählung ihres Bruders nicht mit den beobachteten Verletzungen übereinstimmt. Sara zeigt ein unterwürfiges Verhalten und hat spürbare Angst vor Körperkontakt.

Aufgabe zur Reflexion
(1) Überlegen Sie, welche Herausforderungen mit der Dokumentation von Verfahren zur Beweissicherung verbunden sind. Überlegen Sie, wie behandelnde Ärzt:innen eine detaillierte und genaue Dokumentation durchführen und gleichzeitig die Vertraulichkeit der Patientin/des Patienten wahren können.
(2) Was sind mögliche Anzeichen dafür, dass Sara von Gewalt betroffen ist? Was wären Ihre nächsten Schritte?
(3) Erforschen Sie die emotionalen und psychologischen Auswirkungen der Spurensicherung auf die von Gewalt betroffene Person. Überlegen Sie, wie Sie psychosoziale Unterstützung anbieten können, um das Wohlbefinden der Patientin/des Patienten während des gesamten Prozesses zu gewährleisten.
14. Pädiatrie
Indikatoren für häusliche Gewalt und Anzeichen für eine Gefährdung des Kindes finden Sie in Modul 2.

Eine körperliche Untersuchung und insbesondere eine anogenitale Untersuchung (mit einem Kolposkop) sollte nur mit der Kooperation des Kindes stattfinden. Zwangsmaßnahmen sind kontraindiziert, es sei denn, sie sind medizinisch motiviert. Sie sollten aber ausschließlich in einem klinischen Umfeld stattfinden, damit eine sofortige Versorgung gewährleistet werden kann. Forensische Maßnahmen dürfen nur durchgeführt werden, wenn die sichere Aufbewahrung der entnommenen Proben (Abstriche) gewährleistet ist. 31
Weitere Schritte in der Praxis im Falle eines Verdachts auf körperliche Gewalt gegen Kinder: 32
- Eine weitere Person (z. B. Arzthelfer:in) einbeziehen und deren Namen in der Patient:innenakte dokumentieren.
- Genaue Dokumentation der Anamnese, Aussagen wörtlich zitieren.
- Kontaktieren Sie eine Kinderklinik zur ambulanten Vorstellung (Kinderschutzambulanz) oder lassen Sie sich über das weitere Vorgehen beraten.
- Fotodokumentation, wenn möglich, in der Praxis (Lineal + Farbkarte + Patient:innenname), sonst in der Klinik (Kinderschutzgruppe), möglichst am selben Tag.
Vorgehensweise im Falle eines Verdachts auf sexuelle Gewalt 33
- Bei länger zurückliegenden Vorfällen: allgemeine körperliche Untersuchung in der Praxis (inkl. Entwicklungsstand) und Beurteilung von Verhaltensauffälligkeiten; ggf. anogenitale Untersuchung mit Vorankündigung (notwendig z. B. auf Wunsch des Kindes oder der Eltern).
- Falls noch nicht geschehen, Abklärung von Verdachtsfällen durch eine Risikoeinschätzung: je nach lokalen Strukturen in der Klinik (Kinderschutzgruppe) oder ambulant (z. B. Kinderschutzzentrum).
- Standardisierter Ablauf der Untersuchungen bei Verdacht auf sexuelle Gewalt 34
Die folgende Grafik veranschaulicht den chronologischen diagnostischen Ablauf in Fällen von mutmaßlicher sexueller Gewalt.

Quelle: AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften). (2021). AWMF S3(+) Child abuse and neglect guideline: involving Youth Welfare and Education Services (Child Protection Guideline). Retrieved from https://dgkim.de/wp-content/uploads/2023/07/2021_11_10_langfassung_final_englisch_kkg_update.pdf
Im Blickpunkt: Zahnheilkunde
15. Beweissicherung in der Zahnheilkunde
Medizinische Untersuchung: 35
Menschen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind oder waren, empfinden Zahnarzttermine oft als sehr stressig und belastend. Es handelt sich um eine Situation, die sie als Kontrollverlust erleben können und sich daher ängstlich oder hilflos fühlen. Teilweise können sogar Erinnerungen einer erlebten häuslichen Gewalt auftreten, die zur Retraumatisierung führen können.
> Patientinnen und Patienten können bei der Untersuchung erstarren oder zusammenzucken.
> Die Zahnärztin oder der Zahnarzt sollte versuchen, die Behandlung so angenehm wie möglich zu gestalten. Zum Beispiel, indem man ganz genau das Vorgehen erklärt und welche Instrumente man wann und wie benutzt.
Beweissicherung 36 37
Definition „gerichtsfest“38
- alle notwendigen Angaben, die zur Beurteilung der Verletzung im Rahmen eines juristischen Verfahrens notwendig sind
- möglichst detailreich
- Ableiten einer medizinisch nachvollziehbaren Diagnose und Therapie
- rechtsrelevante Fragen zum Geschehen
Gerichtsfest dokumentieren darf man immer!
Geht dies jedoch über die zahnärztliche Dokumentation hinaus, darf dies nur mit Einwilligung der Patientin oder des Patienten geschehen (z. B. fotografische Dokumentation). Bei der gerichtsfesten Dokumentation helfen vorgegebene Befundbögen.

- 2023 wurde eine aktualisierte Neuauflage des forensischen Befundbogens für Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner veröffentlicht, der die Möglichkeit bietet, alle denkbaren Verletzungsmuster sorgfältig zu dokumentieren.39
- Die Beweise können für einen späteren Zeitpunkt gesichert und aufbewahrt werden, falls sich die Patientin oder der Patient zu einem späteren Zeitpunkt entscheidet zur Polizei zu gehen.
- Willigt die Patientin oder der Patient der weiterführenden Dokumention nicht ein, müssen dennoch alle zahnmedizinischen Befunde in die Krankenakte dokumentiert werden. Auch die Vermutung der häuslichen Gewalt darf intern in die Krankenakte aufgenommen werden.
Die Dent.DocCard© präsentiert die wichtigsten Aspekte einer zahnmedizinischen Intervention bei häuslicher Gewalt und fasst die gerichtsfeste Dokumentation von Verletzungen zusammen. Sie beschreibt, was zu tun ist. Die Karte hilft auch bei der Dokumentation der Größe von Verletzungen (z. B. mittels der Skala auf dieser Karte).

Die Karte kann hier heruntergeladen, mit einer Größe von 99 x 204 mm ausgedruckt und vor Gebrauch laminiert werden: 1 cm auf der Karte entspricht dann 1 cm in der tatsächlichen Größe.
Nützliche Praxisunterlagen zum Herunterladen:
- forensischer Befundbogen
- Patienteninformationen nach Gespräch zur häuslichen Gewalt
- Informationen für Zahnärztinnen und Zahnärzte

Interview mit Frau Dr. Bregulla, einer Zahnärztin am Universitätsklinikum Münster, zum Thema Dokumentation in Fällen von häuslicher Gewalt in der Zahnmedizin:
Wie sollte vorgegangen werden? 40
Die Patientin oder der Patient sollte darüber informiert werden, dass eine gerichtsfeste Dokumentation möglich ist, und es sollte ihre oder seine Zustimmung eingeholt werden:
Stimmt die Patientin oder der Patient nicht zu: zahnmedizinische Befunde (hierzu können auch extraorale Befunde gehören) können dennoch gerichtsfest in der Krankenakte dokumentiert und alle Informationen möglichst detailreich notiert werden.
Stimmt die Patientin oder der Patient zu: der forensische Befundbogen sollte genutzt und fotografisch dokumentiert werden.

Das folgende Schema veranschaulicht, wie bei einem Verdacht auf häusliche Gewalt vorzugehen ist:

„Adaptiertes Modell der Zahnärztekammer: https://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/za/Praev/H%C3%A4usliche_Gewalt/Ablaufdiagramm_Zahnarztpraxis.pdf„
Fallbeispiel: Häusliche Gewalt in der Zahnmedizin – Kieferbruch
Frau Hütte aus dem Fallbeispiel in Modul 3 wies mehrere Hämatome am Hals (linkes Bild unten) kombiniert mit periorbitalen Petechien auf. Außerdem wurde ein Unterkieferbruch im Röntgenbild diagnostiziert (rechtes Bild unten).
Frau Hütte willigt in die gerichtsfeste Dokumentation mit Hilfe des forensischen Befundbogens und auch der fotografischen Dokumentation ein, um die Beweise für einen späteren Zeitpunkt zu sichern.


Außerdem erzählt sie der Zahnärztin, dass sie seit 7 Jahren, also seit sie ihren Mann kennengelernt hat, nicht mehr arbeiten geht. „Martin meinte, dass ich mich dann besser um unser Haus kümmern könne und er ja eh gut für mich sorgen würde.“ Die Abhängigkeit, die dadurch entstanden ist, habe sie lange gar nicht gemerkt. „Nur dann ist er ungefähr vor einem Jahr, als er gesehen hat, wie ich mich mit der Nachbarin unterhalten habe, sehr wütend geworden. Martin mag es nicht, wenn ich mich mit anderen unterhalte. Er sagt, er will mich lieber für sich alleine. Ich habe das lange als liebevoll empfunden. Neulich hat er mich umgestoßen, sodass ich mit dem Unterkiefer auf den Betonboden in der Garage gefallen bin.“
Aufgabe zur Reflexion
(1) Beschreiben Sie als Zahnarzt/Zahnärztin von Frau Hütte die Befunde in der Krankenakte anhand der Informationen in dieser Fallstudie und der weiteren Informationen in den Kapiteln „Dokumentation bei häuslicher Gewalt“ und „Vorgehen in der Zahnmedizin“.
Fallbeispiel: Dokumentation von häuslicher Gewalt in der Zahnheilkunde
Bei Ihrem langjährigen Patienten Amir Müller, der jedoch seit zwei Jahren nicht mehr bei Ihnen zur Behandlung war, erkennen Sie am 30.06.2023 einige Hinweise auf das Vorhandensein von häuslicher Gewalt.
- Sie sehen, dass an Zahn 11 die inzisale Kante abgebrochen ist und der Zahn so um 4 mm kürzer ist als Zahn 21.
- Sie erkennen ein Hämatom am linken Orbitarand (Monokelhämatom), welches bereits gelb-braun gefärbt ist.
- Außerdem erkennen Sie mesial am 36 und okklusal am 27 große kariöse Läsionen, die restaurierungsbedürftig sind.
Sie entschließen sich, Ihre Vermutung in ruhiger Atmosphäre unter vier Augen anzusprechen, Kommunikation Modul 3) und erfahren, dass Ihr Patient seit einiger Zeit unter der immer wiederkehrenden Aggression seines Ehemanns leidet.
Der Patient erzählt Ihnen, dass sein Ehemann Karl Müller vor zwei Wochen abends wütend geworden ist, da er einen wichtigen Kunden auf der Arbeit verloren hat. „Er hat sich dann so in Rage geredet, dass er nicht wusste, wohin mit seiner Wut. Er schlug mich mit der Faust ins Gesicht und traf mein Auge. Dann ist er abgerutscht und traf meinen Kiefer. Er hat sich danach sofort entschuldigt und sagte mehrmals, wie leid ihm das tat.“ Außerdem erzählt er, dass die Wutausbrüche seines Ehemanns öfters passieren. Auf Ihre Nachfrage erzählt Amir, dass sie in letzter Zeit stark zugenommen haben.
Daraufhin sagen Sie zu Amir, dass häusliche Gewalt in keinem Fall toleriert werden darf und bieten ihm Hilfe an, zum Beispiel Informationen über Beratungseinrichtungen und anonyme Hotlines. Der Patient fängt an zu weinen, sagt jedoch, dass er sich erst einmal keine Hilfe holen möchte, da dieser Gewaltausbruch bestimmt der letzte gewesen sei.
Nachdem Sie ihm Zeit gegeben haben, sich zu beruhigen und sich zu sammeln, fragen Sie den Patienten, ob Sie die Verletzungen gerichtsfest dokumentieren dürfen, um sie aufzubewahren, falls er sich zu einem anderen Zeitpunkt entscheiden würde, zur Polizei zu gehen. Er willigt ein, sodass Sie mit einer fotografischen Dokumentation mit Maßstab beginnen. Wegen akuten Schmerzen und dem Verdacht auf eine Intrusion des Zahns 11 machen Sie außerdem eine Abformung und fertigen einen Zahnfilm zur Überprüfung des Parodontalspalts an.
Aufgabe zur Reflexion
(1) Welche Indikatoren sind im Fallbeispiel aufgeführt, die auf das Vorhandensein von häuslicher Gewalt hindeuten?
(2) Beschreiben Sie als Zahnarzt/Zahnärztin von Frau Hütte die Befunde in der Krankenakte anhand der Informationen in dieser Fallstudie und der weiteren Informationen in den Kapiteln „Dokumentation bei häuslicher Gewalt“ und „Vorgehen in der Zahnmedizin“.
Einen weiteren Fall zum Üben der Dokumentation finden Sie hier.
Quellen
- Warm Springs Health and Wellness Center Domestic Violence Protocol „Guidelines for Clinical Assessment and Intervention“, accessed: 06.12.23
↩︎ - Ladd M, Seda J. Sexual Assault Evidence Collection. [Updated 2023 Jan 29]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554497/ ↩︎
- S.I.G.N.A.L. e.V., „Gerichtsfeste Dokumentation und Spurensicherung nach häuslicher und sexueller Gewalt„, Empfehlungen für Arztpraxen und Krankenhäuser in Berlin, 2018, p. 5
https://www.signal-intervention.de/sites/default/files/2020-04/Infothek_Empfehlungen_Doku_2018_0.pdf ↩︎ - “A National Protocol for Intimate Partner Violence Medical Forensic Examinations”, U.S. Department of Justice Office on Violence Against Women, May 2023, p. 71, accessed 26.11.23.
https://www.safeta.org/wp-content/uploads/2023/05/IPVMFEProtocol.pdf ↩︎ - S.I.G.N.A.L. e.V., „Gerichtsfeste Dokumentation und Spurensicherung nach häuslicher und sexueller Gewalt“, Empfehlungen für Arztpraxen und Krankenhäuser in Berlin, 2018, p. 5
https://www.signal-intervention.de/sites/default/files/2020-04/Infothek_Empfehlungen_Doku_2018_0.pdf ↩︎ - S.I.G.N.A.L. e.V., „Gerichtsfeste Dokumentation und Spurensicherung nach häuslicher und sexueller Gewalt„, Empfehlungen für Arztpraxen und Krankenhäuser in Berlin, 2018, p. 5
https://www.signal-intervention.de/sites/default/files/2020-04/Infothek_Empfehlungen_Doku_2018_0.pdf ↩︎ - „A National Protocol for Intimate Partner Violence Medical Forensic Examinations“, U.S. Department of Justice Office on Violence Against Women, May 2023, accessed 3.12.23.
https://www.safeta.org/wp-content/uploads/2023/05/IPVMFEProtocol.pdf ↩︎ - Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in Deutschland, Universität Bielefeld, 2012. https://www.bmfsfj.de/resource/blob/94204/3bf4ebb02f108a31d5906d75dd9af8cf/lebenssituation-und-belastungen-von-frauen-mit-behinderungen-kurzfassung-data.pdf ↩︎
- S.I.G.N.A.L. e.V., „Gerichtsfeste Dokumentation und Spurensicherung nach häuslicher und sexueller Gewalt„, Empfehlungen für Arztpraxen und Krankenhäuser in Berlin, 2018 ↩︎
- Stanford Medicine, Domestic Abuse “Documenting”, accessed 22.11.23 ↩︎
- DOCUMENTING CLINICAL EVIDENCE OF ABUSE- “FIRST DO NO HARM”
BMC Domestic Violence Program, November 2020, p. 2, accessed 01.12.23.
https://www.bumc.bu.edu/gimcovid/files/2021/01/Abuse-Documentation-Guide-2020.pdf ↩︎ - DOCUMENTING CLINICAL EVIDENCE OF ABUSE- “FIRST DO NO HARM”
BMC Domestic Violence Program, November 2020, p. 2, accessed 01.12.23.
https://www.bumc.bu.edu/gimcovid/files/2021/01/Abuse-Documentation-Guide-2020.pdf ↩︎ - World Health Organization (WHO). (2015). Clinical guidelines for responding to intimate partner violence and sexual violence against women, p. 28. Retrieved from https://www.unodc.org/documents/publications/WHO_RHR_15.24_eng.pdf ↩︎
- World Health Organization (WHO). (2015). Clinical guidelines for responding to intimate partner violence and sexual violence against women, p. 15. Retrieved from https://www.unodc.org/documents/publications/WHO_RHR_15.24_eng.pdf ↩︎
- World Health Organization (WHO). (2015). Clinical guidelines for responding to intimate partner violence and sexual violence against women, p. 27. Retrieved from https://www.unodc.org/documents/publications/WHO_RHR_15.24_eng.pdf ↩︎
- World Health Organization (WHO). (2015). Clinical guidelines for responding to intimate partner violence and sexual violence against women, p. 30. Retrieved from https://www.unodc.org/documents/publications/WHO_RHR_15.24_eng.pdf ↩︎
- World Health Organization (WHO). (2015). Clinical guidelines for responding to intimate partner violence and sexual violence against women, p. 27. Retrieved from https://www.unodc.org/documents/publications/WHO_RHR_15.24_eng.pdf ↩︎
- „A National Protocol for Intimate Partner Violence Medical Forensic Examinations“, U.S. Department of Justice Office on Violence Against Women, May 2023, p. 44, accessed 22.11.23.
https://www.safeta.org/wp-content/uploads/2023/05/IPVMFEProtocol.pdf ↩︎ - „A National Protocol for Intimate Partner Violence Medical Forensic Examinations“, U.S. Department of Justice Office on Violence Against Women, May 2023, p. 65, accessed 22.11.23.
https://www.safeta.org/wp-content/uploads/2023/05/IPVMFEProtocol.pdf ↩︎ - „A National Protocol for Intimate Partner Violence Medical Forensic Examinations“, U.S. Department of Justice Office on Violence Against Women, May 2023, p. 77, accessed 20.11.23.
https://www.safeta.org/wp-content/uploads/2023/05/IPVMFEProtocol.pdf ↩︎ - „A National Protocol for Intimate Partner Violence Medical Forensic Examinations“, U.S. Department of Justice Office on Violence Against Women, May 2023, p. 77, accessed 20.11.23.
https://www.safeta.org/wp-content/uploads/2023/05/IPVMFEProtocol.pdf ↩︎ - [1] „A National Protocol for Intimate Partner Violence Medical Forensic Examinations“, U.S. Department of Justice Office on Violence Against Women, May 2023, p. 86, accessed 20.11.23.
https://www.safeta.org/wp-content/uploads/2023/05/IPVMFEProtocol.pdf ↩︎ - „A National Protocol for Intimate Partner Violence Medical Forensic Examinations“, U.S. Department of Justice Office on Violence Against Women, May 2023, p. 86, accessed 21.11.23.
https://www.safeta.org/wp-content/uploads/2023/05/IPVMFEProtocol.pdf ↩︎ - „A National Protocol for Intimate Partner Violence Medical Forensic Examinations“, U.S. Department of Justice Office on Violence Against Women, May 2023, accessed 21.11.23.
https://www.safeta.org/wp-content/uploads/2023/05/IPVMFEProtocol.pdf ↩︎ - A National Protocol for Intimate Partner Violence Medical Forensic Examinations“, U.S. Department of Justice Office on Violence Against Women, May 2023, p. 44, accessed 22.11.23.
https://www.safeta.org/wp-content/uploads/2023/05/IPVMFEProtocol.pdf ↩︎ - „A National Protocol for Intimate Partner Violence Medical Forensic Examinations“, U.S. Department of Justice Office on Violence Against Women, May 2023, p. 99, accessed 23.11.23.
https://www.safeta.org/wp-content/uploads/2023/05/IPVMFEProtocol.pdf ↩︎ - Ärztekammer des Saarlands. (2016). Häusliche Gewalt, Erkennen Behandeln Dokumentieren: Eine Information für Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte. Ministerium der Justiz, Saarland. https://www.aerztekammer-saarland.de/files/157BE0C16DE/Haeusliche_Gewalt_erkennen_behandeln_dokumentieren_2016.pdf ↩︎
- Gesetze im Internet. (2024). Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG): § 4 Beratung und Übermittlung von Informationen durch Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung. Bundesministerium der Justiz; Bundesamt für Justiz. https://www.gesetze-im-internet.de/kkg/__4.html ↩︎
- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. (2017). Kinderschutz-Hotline für medizinisches Fachpersonal geht bundesweit an den Start. https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/kinderschutz-hotline-fuer-medizinisches-fachpersonal-geht-bundesweit-an-den-start-117722 ↩︎
- Cecchi, R., Masotti, V., Sassani, M., Sannella, A., Agugiaro, G., Ikeda, T., Pressanto, D. M., Caroppo, E., Schirripa, M. L., Mazza, M., Kondo, T., & De Lellis, P. (2023). Femicide and forensic pathology: Proposal for a shared medico-legal methodology. Legal medicine (Tokyo, Japan), 60, 102170. https://doi.org/10.1016/j.legalmed.2022.102170 ↩︎
- Institut für Qualität im Gesundheitswesen Nordrhein „Notfall- und Informationskoffer: Kinderschutz in der Arztpraxis und Notaufnahme“
https://www.aekno.de/fileadmin/user_upload/aekno/downloads/2023/Kindernotfallkoffer.pdf ↩︎ - Institut für Qualität im Gesundheitswesen Nordrhein „Notfall- und Informationskoffer: Kinderschutz in der Arztpraxis und Notaufnahme“ https://www.aekno.de/fileadmin/user_upload/aekno/downloads/2023/Kindernotfallkoffer.pdf ↩︎
- Institut für Qualität im Gesundheitswesen Nordrhein „Notfall- und Informationskoffer: Kinderschutz in der Arztpraxis und Notaufnahme“ https://www.aekno.de/fileadmin/user_upload/aekno/downloads/2023/Kindernotfallkoffer.pdf ↩︎
- AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften). (2021). AWMF S3+ Leitlinie Kindesmisshandlung, -missbrauch, -vernachlässigung unter Einbindung der Jugendhilfe und Pädagogik(Kinderschutzleitlinie), https://dgkim.de/wp-content/uploads/2023/07/2022_01_03_langfassung_update-kjsg.pdf ↩︎
- Jailwala, M., Brewer Timmons, J., Gül, G. & Ganda, K. (2016). Recognize the Signs Of Domestic Violence: Oral health professionals need to be aware of the symptoms of domestic violence and how to assist victims. Decisions in Dentistry. https://decisionsindentistry.com/article/recognize-the-signs-of-domestic-violence/ ↩︎
- Bundeszahnärztekammer. (2024). Häusliche Gewalt: Umgang mit Opfern häuslicher Gewalt in der zahnärztlichen Praxis. https://www.bzaek.de/recht/haeusliche-gewalt.html ↩︎
- Graß, H. L., Gahr, B. & Ritz-Timme, S. (2016). Umgang mit Opfern von häuslicher Gewalt in der ärztlichen Praxis. Anregungen für den Praxisalltag [Dealing with victims of domestic violence. Suggestions for daily practice]. Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz, 59(1), 81–87. https://doi.org/10.1007/s00103-015-2269-4 ↩︎
- Jungbluth, P., Wild, M., Hakimi, M., Betsch, M., Dassler, K., Möller-Herckenhoff, L., Windolf, J., Ritz-Timme, S. & Graß, H. (2012). Qualität der Befunddokumentation und weiterführenden Betreuung von Gewaltopfern am Beispiel einer unfallchirurgischen Notaufnahme einer Großstadt [Quality of documentation and care for victims of violence for the example of a trauma surgery emergency department in a major city]. Zeitschrift fur Orthopadie und Unfallchirurgie, 150(1), 89–97. https://doi.org/10.1055/s-0031-1280168 ↩︎
- Zahnärztekammer Nordrhein. (2024). Hilfe für Opfer von Gewalt: Forensischer Befundbogen. https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/zahnaerzte/praxiswissen-und-behandlung/forensischer-befundbogen/forensischer-befundbogen/ ↩︎
- Ärztekammer des Saarlands. (2016). Häusliche Gewalt, Erkennen Behandeln Dokumentieren: Eine Information für Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte. Ministerium der Justiz, Saarland. https://www.aerztekammer-saarland.de/files/157BE0C16DE/Haeusliche_Gewalt_erkennen_behandeln_dokumentieren_2016.pdf ↩︎



