1. Organisationsübergreifende-Zusammenarbeit
2. Risikobewertung
3. Zusammenarbeit zwischen Behörden mit Fokus auf die Polizei
4. Strafverfahren in Fällen von häuslicher Gewalt
5. Strafverfahren bei häuslicher Gewalt in Deutschland
6. Exkurs: Häusliche Gewalt in Krisenzeiten – Herausforderungen für behördenübergreifende Zusammenarbeit
Quellen
Zielgruppe
In diesem Modul finden sich Lehrmaterialien für Trainer:innen, die in der Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitenden der Polizei tätig sind, die beruflich mit Betroffenen von häuslicher Gewalt zu tun haben. Das Modul wurde ausschließlich für Professionelle in diesem Bereich konzipiert und ist nicht an Betroffene häuslicher Gewalt oder ihr unmittelbares soziales Umfeld gerichtet.
Kurzer Überblick über Modul 7
Modul 7 bietet einen Überblick über generelle Prinzipien der organisationsübergreifenden Zusammenarbeit und Strafverfahren in Fällen häuslicher Gewalt. Dabei werden sowohl ein genereller Überblick gegeben als auch die Besonderheiten im deutschen Rechtssystem vorgestellt.
Folgende Ziele können Sie als Trainer:in mithilfe des Moduls 7 verfolgen:
+ Ein vertieftes Verständnis von Kursteilnehmenden für die Arbeitsweise von Ersthelfenden und Fachkräften, mit besonderem Fokus auf die Polizei.
+ Ein erweitertes Bewusstsein für die Wirksamkeit interdisziplinärer und multiprofessioneller Zusammenarbeit im Umgang mit häuslicher Gewalt.
+ Ein fundiertes Wissen über allgemeine sowie nationale strafrechtliche Verfahren und Abläufe im Kontext häuslicher Gewalt.
1. Organisationsübergreifende Zusammenarbeit1

Wie kann man von sexualisierter Gewalt betroffenen Frauen helfen?
Der folgende Aufklärungsfilm des WEISSEN RINGS erklärt, wie sie Personen unterstützen können, die sexualisierter Gewalt erleben oder erlebt haben, wenn sie den Täter oder die Täterin verlassen möchten.
2. Risikobewertung
Untertitel aktivieren: Klicken Sie während des Abspielens im Bildschirmbereich unten auf das Untertitel-Symbol (kleines Viereck mit Strichen). Der Untertitel wird direkt eingeblendet. Um die Untertitelsprache zu ändern, klicken Sie auf das Zahnrad daneben und wählen unter „Untertitel“ die gewünschte Sprache aus. Hier geht es zu einem Erklärvideo.
Risikobewertungsinstrumente7
Bitte beachten Sie, dass die meisten Risikobewertungen die Aspekte Geschlecht/Gender nicht ausdrücklich berücksichtigen. Oftmals sind in diesen Instrumenten entweder beide Geschlechter in den Checklisten nicht vorgesehen oder es wird ausschließlich die männliche Form verwendet, wenn von Täter:innen die Rede ist. Hier finden Sie weitere Informationen.
3. Zusammenarbeit zwischen Behörden mit Fokus auf die Polizei
Überweisungen an Anbieter von Gesundheits- und Sozialdiensten
Zusammenarbeit mit anderen Dienstleistungsanbietern, um integrierte Protokolle und effektive Überweisungsnetzwerke zu entwickeln und zu implementieren:
- Vernetzung der Opfer mit den erforderlichen Gesundheits- und Sozialdiensten wie Notunterkünften sowie medizinischen und psychologischen Versorgungseinrichtungen
- Koordination von Folgemaßnahmen und deren Institutionalisierung
- Entwickeln von Standards für Überweisungsdienste
- Sicherstellen, dass die gesamte Kommunikation zwischen den Dienstleistungs-anbietern urteilsfrei, einfühlsam und unterstützend ist
- Feststellen des Bedarfs an standardisierten Datenaustauschprotokollen
Kommunikation zwischen Justizbehörden
Gewährleistung eines wirksamen Informationsaustauschs zwischen den Anbietern von Justizdienstleistungen:
- Opfer oder Überlebende und/oder die Eltern/Erziehungsberechtigten und Rechtsvertreter/innen werden, wo immer möglich, um eine informierte Zustimmung zur Weitergabe von Informationen gebeten.
- Informationen werden im Rahmen der Datenschutz- und Vertraulichkeitserfordernisse weitergegeben.
- Informationen sollten nur für den Zweck, für den sie beschafft oder zusammengestellt wurden, oder für eine mit diesem Zweck übereinstimmende Verwendung offengelegt werden.
- Protokolle und Überweisungsmechanismen, die einen zeitnahen und effizienten Informationsfluss zwischen den verschiedenen Diensten fördern, sollten entwickelt werden.
Verfahren und Informationsaustausch
Die verschiedenen Dienstleister legen schriftliche Verfahren zur Risikobewertung und zum Risikomanagement fest, insbesondere zu Zielen, Verantwortlichkeiten und Rollen der Fachleute sowie zu Dauer und Methoden der Risikobewertung und des Risikomanagements, nämlich:
- zur Ermittlung relevanter Informationsquellen, wie z. B. die vom Opfer/Überlebenden aufgedeckte Geschichte der Gewalt,
- zur Definition der zu verwendenden Instrumente,
- zum Entwurf von Plänen zur Situationssicherheit.
Die aus der Risikoabschätzung gewonnenen Informationen sollten in einem klaren und objektiven schriftlichen Bericht enthalten sein und mehrere Bereiche abdecken: Gewaltgeschichte, psychosoziale Vorgeschichte, aktuelle psychosoziale Anpassung des Täters/der Täterin, Kontext der Erfahrungen der Opfer/Überlebenden und eine schlüssige Stellungnahme zum dargestellten Gewaltrisiko.
Die multiinstitutionelle Zusammenarbeit ist für eine erhöhte Sicherheit von Frauen und Kindern von größter Bedeutung und erfordert einen Prozess des Informationsaustausches.
Der Informationsaustausch zwischen verschiedenen Organisationen kann dazu beitragen:
- neue Ideen und Lösungen im Bereich der Prävention und Intervention zu finden und diese kohärenter und effektiver zu gestalten,
- die Komplexität der Gewaltdynamik des Falles zu erfassen,
- erneute häusliche Gewalt zu reduzieren.
Der Informationsaustausch kann mit einem der Grundprinzipien der Intervention in Konflikt geraten: der Vertraulichkeit und dem Recht auf Privatsphäre. Strategien der Informationssammlung und -verbreitung müssen anerkannte ethische Standards unter Achtung der Menschenrechte berücksichtigen.
Die Weitergabe von Informationen sollte den folgenden Prinzipien entsprechen:
- Sicherheit: Informationen sollten auf sichere Weise weitergegeben werden und das Risiko für das Opfer/den/die Überlebende/n und die Kinder nicht dadurch erhöhen, dass sie sich in einer verletzlicheren Situation befinden;
- Objektivität: Informationen sollten auf objektive Weise und ohne Beurteilung/Verurteilung übermittelt werden;
- Notwendigkeit: Es sollten nur Informationen berücksichtigt werden, die für die Erstellung eines wirksamen Sicherheitsplans relevant sind.

Quelle: übersetzt aus Avaliação e Gestão de Risco em Rede: Manual para Profissionais [Vernetzte Risikobewertung und -management: Handbuch für Fachleute], herausgegeben von der Frauenvereinigung gegen Gewalt (AMCV), Lissabon: 2013 (nur portugiesische Fassung) ISBN: 978-989-98600-1-8
Szenario: Opfer erstattet Anzeige ohne aktuellen Vorfall
Das Opfer kommt auf ein Polizeirevier und erstattet Anzeige, ohne dass ein aktueller Vorfall vorliegt.
Aufgabe
Diskutieren Sie Folgendes:
Welche Maßnahmen stehen Ihnen zur Verfügung?
Die Antworten auf diese Aufgabe sind in den entsprechenden Abschnitten dieses Moduls zu finden.
Mögliche Antworten
- Klärung und Aufnahme des Sachverhalts: Wer ist der Täter/die Täterin? Wie viele Vorfälle häuslicher Gewalt gab es? Über welchen Zeitraum? In welcher Intensität? Etc.
- Suche nach Möglichkeiten nachträglicher Beweissicherung: Gab es Zeug*innen? Gab es Arztbesuche? Gibt es Anvertraute? Gibt es Beweise in anderer Form?
- Aufklärung über Rechte und Pflichten sowie den Verfahrensablauf
- Gefährdungsbewertung und ggf. Initiierung der notwendig erscheinenden Schutzmaßnahmen (mit Bezug auf den Täter beispielsweise: Gefährderansprache, Wegweisung, Annäherungs- und Kontaktverbot, Ingewahrsamnahme; mit Bezug auf das Opfer: Opferschutzgespräch, ggf. Schutzunterkunft)
- Weitergabe von Informationen über Unterstützungsangebote (NGOs, öffentlicher Sektor)
- Vermittlung ins Hilfsnetzwerk, bspw. durch proaktiven Ansatz
- Informieren des Opfers über Opferrechte und zivilrechtliche (Schutz-)Möglichkeiten

4. Strafverfahren in Fällen von häuslicher Gewalt
5. Strafverfahren bei häuslicher Gewalt in Deutschland
Wie läuft ein Polizeieinsatz ab?
- Wenn die Polizei durch einen Notruf gerufen wurde, begibt sich ein Team des Streifendiensts zum Einsatzort. Häufig wissen die Beamt:innen nicht genau, was sie erwartet und auf welche Situation sie vor Ort treffen werden (bspw. ob durch einen Aggressor, eventuell zusätzlich unter Alkoholeinfluss, weiterhin akute Gefahr für beteiligte Personen oder auch sie selbst besteht).
- Vor Ort ist es das Ziel des Einsatzes, die Situation zu erfassen und möglichst die Sicherheit aller Beteiligten wiederherzustellen. Dies kann teilweise dadurch erschwert werden, dass bspw. Nachbar:innen die Polizei verständigt haben, die Personen aus der betroffenen Wohnung der Polizei allerdings den Zutritt verwehren können. Es ist Aufgabe der Polizei, in jeder Konstellation die Gefahr einzuschätzen und die Sicherheit der Beteiligten zu gewährleisten. Ebenfalls sind die Beamt:innen gesetzlich verpflichtet, das Opfer über seine Rechte aufzuklären. Hierzu können Sprachmittlung und Unterlagen genutzt werden. Da sowohl die Gefahrensituation als auch der Polizeieinsatz einen stressvollen Moment für Betroffene darstellt, gestaltet sich dieses Informationsgebot häufig sehr herausfordernd.
- Vor Ort ist es für die Gewaltbetroffenen möglich, Strafanzeige zu erstatten. Sobald dies geschehen ist, ist die Polizei verpflichtet, Ermittlungen aufzunehmen und Beweise zu sichern. Eine Anzeige kann auch im Nachgang erfolgen.
- Im Jahr 2001 wurde das Gewaltschutzgesetz eingeführt, welches sich mit dem Opferschutz, dem Umgang mit dem Täter/der Täterin und der damit einhergehenden Polizeiarbeit befasst. Zusätzlich wurde 2021 eine deutschlandweite Definition von häuslicher Gewalt in das Gewaltschutzgesetz aufgenommen, sodass alle Bundesländer den gleichen Rahmen für lokale Gesetze zu häuslicher Gewalt verwenden können. Diese Definition ist jedoch noch nicht zwangsläufig in den einzelnen Landesgesetzen umgesetzt.
- Es ist wichtig zu wissen, dass die Strafverfolgung in Deutschland in die Zuständigkeit der Bundesländer fällt, was bedeutet, dass das Verfahren von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein kann. In einigen Bundesländern wird die Räumung des Täters/der Täterin nicht unbedingt von den Verwaltungsgerichten, sondern eher von den örtlichen Polizeibehörden oder den kommunalen Ordnungsämtern durchgeführt, z.B. in Baden-Württemberg. Es ist daher ratsam, sich mit einer lokalen Polizeibehörde in Verbindung zu setzen, um eine Ansprechperson im Falle des Bedarfs zu haben. In vielen Bundesländern gibt es sog. Interventionsstellen für häusliche Gewalt, in denen polizeiliche Sachbearbeitende in Opferschutzfragen arbeiten. Sich ein interdisziplinäres Netzwerk aufzubauen kann helfen, betroffenen Personen schnell die passende Unterstützung anzubieten.
Was passiert nach einem Polizeieinsatz?
- In akuten Gefahrensituationen ist die Polizei befugt, eine einstweilige Verfügung zu erlassen, die die Entfernung des Täters/der Täterin aus der Wohnung in der akuten Situation und ein Rückkehrverbot für bis zu zehn Tage beinhaltet. Außerdem kann die Polizei ein Kontaktverbot sowie ein Annäherungsverbot aussprechen. Täter:innen, die gegen eine dieser Schutzmaßnahmen verstoßen, können mit einer Geldstrafe belegt werden.
- Je nach Region und/oder Polizeidienststelle verteilt die Polizei Flyer (oder auch: Opferschutzblatt) an Betroffene, die Kontaktdaten von relevanten Akteuren der Unterstützungssysteme enthalten, wie z. B. das bundesweite Hilfetelefon für Gewalt gegen Frauen (116 016), Beratungsstellen und Kontaktpersonen für Frauenhäuser. Viele Polizeidienststellen in Deutschland arbeiten mit Opferhilfsdiensten zusammen und fragen die gewaltbetroffene Person ob eine Beratungsstelle proaktiv Kontakt zu ihnen aufnehmen kann, um z.B. Unterstützung bei der Strafanzeige und dem anschließenden Verfahren anzubieten. Die Kosten der Unterbringung in den Frauenhäusern werden für viele Frauen und ihre Kinder über den Bezug von Sozialleistungen gedeckt. Frauen, die keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben, müssen die Kosten selbst tragen.
Das folgende Video zeigt, wie eine Mitarbeiterin eines Opferhilfsdienstes nach einem Polizeieinsatz Kontakt mit der betroffenen Frau aufnimmt:
In dem folgenden Aufklärungsfilm des WEISSEN RINGS wird erklärt, wie der WEISSE RING Betroffenen hilft, wenn diese einen Täter oder eine Täterin verlassen wollen. Der WEISSE RING unterstützt zudem zahlreiche Personen, die unter sexualisierter Gewalt gelitten haben oder leiden.
- Sobald die Polizei über eine Straftat informiert wird, ist sie zur Strafverfolgung verpflichtet. Wenn die betroffenen Personen über die Straftat schweigen und nicht aussagen wollen, nimmt die Polizei den Fall auf und stellt ihn ein, wenn die Straftat nicht schwerwiegend genug ist oder wenn keine weiteren Beweise vorliegen. Er kann wieder aufgenommen werden, wenn neue Vorfälle auftreten.
- Wenn Kinder Zeug:innen oder selbst von häuslicher Gewalt betroffen sind, meldet die Polizei den Vorfall in jedem Fall dem Jugendamt. Jede mögliche Schädigung eines Kindes oder eines Jugendlichen wird hierbei als relevant angesehen. Das Jugendamt bietet Eltern und Kindern (rechtliche) Unterstützung, setzt sich für den Kinderschutz ein und hat durch seine Entscheidungsbefugnis eine „Schutzfunktion“ inne. Ihm obliegt die Entscheidung über das weitere Vorgehen zum Wohlergehen des Kindes.
- In vielen deutschen Städten gibt es die Möglichkeit, Verletzungen oder andere Anzeichen von Gewalt durch medizinisches Fachpersonal dokumentieren zu lassen. Dieser Service ist kostenlos und soll die Hemmschwelle senken, Fälle von häuslicher Gewalt anzuzeigen. Wenn die betroffene Person beschließt, Strafanzeige zu erstatten, können diese Beweise verwendet werden. Das medizinische Personal ist rechtlich nicht befugt, ohne die Zustimmung der gewaltbetroffenen Person Informationen an die Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben.
- Fälle häuslicher Gewalt, die in Deutschland nicht die Kriterien für eine Strafverfolgung erfüllen oder bei denen betroffene Personen keine Strafanzeige erstatten, werden in der Regel als Verwaltungsangelegenheit behandelt. Dieses Verfahren umfasst in der Regel die Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden und kann je nach Bundesland unterschiedlich sein. Der Täter/die Täterin hat das Recht, gegen den Verwaltungsakt Einspruch zu erheben oder ihn in Revision zu bringen. In diesen Fällen können sich weitere rechtliche Schritte und Verfahren anschließen.
- Sobald eine gewaltbetroffene Person Anzeige erstattet hat und die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen sind, leitet die Polizei die Akte an die Staatsanwaltschaft weiter, die den Inhalt prüft und den Fall entweder einstellt oder zur Verhandlung an das Gericht weiterleitet. Die Betroffenen können auch direkt bei der Staatsanwaltschaft eine Anzeige erstatten, was jedoch kaum geschieht. Je nach individuellem Verlauf (oft aufgrund von Beweisen und der Schwere der Straftat) kann die Staatsanwaltschaft entweder einen Strafbefehl erlassen (ohne Verhandlung vor einem Gericht) oder Anklage erheben. Die Mehrzahl der zur Strafanzeige gebrachten Fälle häuslicher Gewalt werden wegen geringfügiger Beweislast oder fehlender Aussagebereitschaft von Opfer-Zeug:innen eingestellt.
- Wenn die Kriterien für eine Strafverfolgung erfüllt sind, sind möglicherweise zwei Gerichte beteiligt: Fälle von Sorgerecht, Unterhalt und Vereinbarungen über gemeinsame Wohnungen werden vor dem Familiengericht verhandelt. Fälle von Gewalt zwischen zwei Partnern vor dem Strafgericht. In der Regel erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Täter oder die Täterin. In Fällen von schwerer Gewalt können die davon betroffenen Personen zusätzlich Anzeige erstatten. Dies ermöglicht eine aktive Rolle während des Gerichtsverfahrens.
- Während des Gerichtsverfahrens haben Minderjährige und solche, die von schwerer Gewalt bedroht sind, ein Recht auf psychosoziale Prozessbegleitung. In diesen Fällen begleitet dieser kostenlose Dienst die betroffenen Personen während des Prozesses, unterstützt sie und erklärt ihnen den Ablauf des Verfahrens. Auch andere Betroffene können diese Leistung beantragen oder gegen private Bezahlung in Anspruch nehmen. In der Regel sagen der Täter/die Täterin und die von Gewalt betroffene Person persönlich im Gerichtssaal aus, aber sie können beantragen, in einem separaten Raum oder per Video befragt zu werden. Migrant:innen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind und deren Aufenthaltsstatus an ihren Ehepartner:innen gebunden ist, können einen besonderen Härtefall im Aufenthaltsrecht beantragen.
- Die Strafen für häusliche Gewalt variieren je nach Schwere der Straftat(en) zwischen Geld- und Freiheitsstrafen. Die Täter/die Täterin können dazu verurteilt werden, an Kursen teilzunehmen, um beispielsweise Selbstregulierungsfähigkeiten oder Konfliktlösungsstrategien zu erlernen. Zu berücksichtigen ist, dass alle Möglichkeiten der Täter:innenberatung und Intervention nur erfolgreich sein können, wenn die gewalttätige Person bereit ist, ihr (gewaltvolles) Beziehungsverhalten zu bearbeiten und zu ändern.
In dem folgenden Video wird gezeigt, wie man durch Einzel- und Gruppenberatung Männer dabei unterstützen kann, Gewalt zu überwinden:

6. Exkurs: Häusliche Gewalt in Krisenzeiten – Herausforderungen für behördenübergreifende Zusammenarbeit
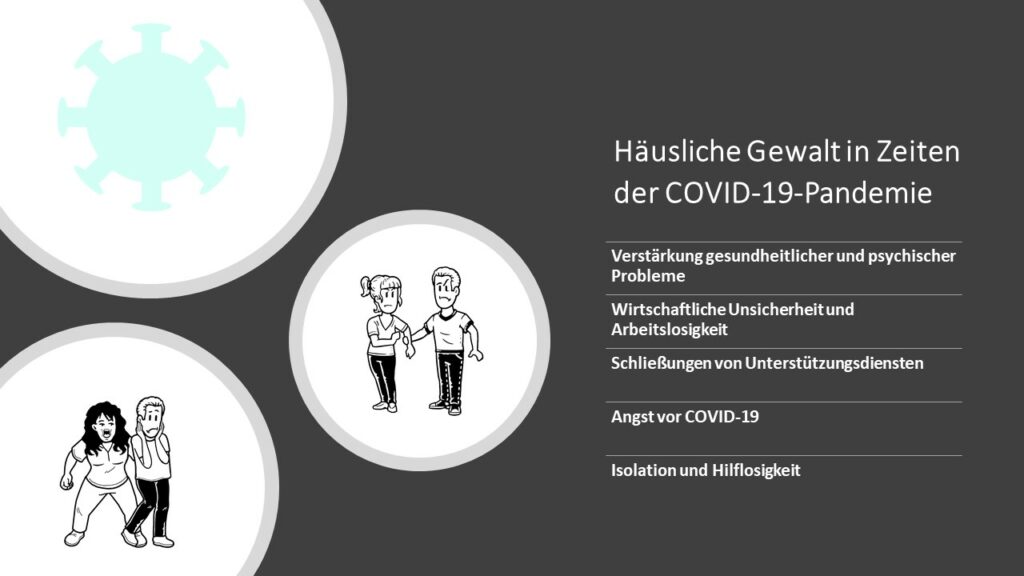
COVID-19-Pandemie in Deutschland
Am 16. März 2020 wurde in den 16 deutschen Bundesländern zu unterschiedlichen Zeitpunkten lokale Lockdowns wegen der Risiken der Covid-19-Pandemie von den Behörden angeordnet. Die Durchsetzung der Quarantänevorschriften war hierbei unterschiedlich geregelt. Im April kam jedoch fast ganz Deutschland zum Stillstand: Home-Office und Online-Unterricht wurden eingeführt.
Einige Risikofaktoren für die Zunahme von häuslicher Gewalt waren:
- Gesundheitliche und psychische Probleme können sich während eines Lockdowns verstärken, da gesundheitsrelevante Serviceleistungen nur eingeschränkt zugänglich sind. Dies kann sich wiederum negativ auf den Gesundheitszustand Einzelner auswirken, ihr Stressniveau erhöhen und eine Zunahme gewalttätiger Übergriffe begünstigen.
- Mit wirtschaftlichrn Unsicherheit oder Arbeitslosigkeit gehen finanzielle Sorgen einher, die destruktive Bewältigungsmechanismen verstärken können.
- Gewalt hat immer auch etwas mit Machtanspruch zu tun. In Zeiten von Krise und Isolation und damit verbundener gefühlter Hilflosigkeit, Kontrollverlust und Machtlosigkeit ist Gewalt vermeintlich ein Mittel, um Kontrolle und Macht zurückzugewinnen.
- Sprachbarrieren, Schließungen von Anlaufstellen oder die eingeschränkte Präsenz von Sozialarbeitenden aufgrund der Schutzmaßnahmen erschweren den Zugang zu Unterstützungsangeboten deutlich.
- Betroffene von häuslicher Gewalt zögerten zudem aus Angst, sich mit COVID-19 anzustecken, Unterstützungsangebote in Anspruch zu nehmen.
- Die soziale Distanzierung kann die sozialen Kontakte Einzelner so stark einschränken, dass es gewaltbetroffene Personen ohne die Nähe und Ermutigung von Bezugspersonen nicht wagen, Hilfe zu suchen. Ebenso werden Bezugspersonen, Bekannte oder Außenstehende wie Arbeitgeber:innen oder pädagogische Fachkräfte nicht auf Gewalt aufmerksam und können nicht unterstützend agieren. Andererseits sind Nachbarn und Nachbarinnen wachsamer und präsenter und aufgrund der Ausgangsbeschränkungen als protektiver Faktor zu berücksichtigen.15
Quellen
- https://www.improdova.eu/pdf/IMPRODOVA_D2.4_Gaps_and_Bridges_of_Intra-_and_Interagency_Cooperation.pdf?m=1585673383& ↩︎
- https://www.improdova.eu/pdf/IMPRODOVA_D2.4_Gaps_and_Bridges_of_Intra-_and_Interagency_Cooperation.pdf?m=1585673383& ↩︎
- Kropp, P. R. (2004). Some Questions Regarding Spousal Assault Risk Assessment. Violence Against Women, 10(6), 676–697. https://doi.org/10.1177/1077801204265019 ↩︎
- Svalin, K. & Levander, S. (2019). The Predictive Validity of Intimate Partner Violence Risk Assessments Conducted by Practitioners in Different Settings—a Review of the Literature. Journal of Police and Criminal Psychology. 35. https://doi.org/10.1007/s11896-019-09343-4 ↩︎
- Mann, L., & Tosun, Z. (2020, October 23). ASSESSING AND MANAGING RISKS IN CASES OF VIOLENCE AGAINST WOMEN AND DOMESTIC VIOLENCE. Council of Europe, p. 9. ↩︎
- EIGE “Risk assessment and risk management – Principle 4: Adopting an intersectional approach”, accessed 06.02.2024. https://eige.europa.eu/gender-based-violence/risk-assessment-risk-management/principle-4-adopting-intersectional-approach ↩︎
- https://www.improdova.eu/pdf/IMPRODOVA_D2.3_Risk_Assessment_Tools_and_Case_Documentation_of_Frontline_Responders.pdf?m=1585673380& ↩︎
- Campbell, J. C., Webster, D. W., & Glass, N. (2009). The Danger Assessment: Validation of a Lethality Risk Assessment Instrument for Intimate Partner Femicide. Journal of Interpersonal Violence, 24(4), 653-674. https://doi.org/10.1177/0886260508317180. ↩︎
- https://www.dangerassessment.org/About.aspx ↩︎
- Hilton, N. Z., Harris, G. T., Rice, M. E., Houghton, R., & Eke, A. W. (2008). An indepth actuarial risk assessment for wife assault recidivism: The Domestic Violence Risk Appraisal Guide. Law and Human Behavior, 32, 150-163. doi:10.1007/s10979-007-9088-6. ↩︎
- https://books.google.co.uk/books?id=p1JoYbAAN7QC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false ↩︎
- https://safelives.org.uk/practice-support/resources-identifying-risk-victims-face ↩︎
- For more details see: https://www.theduluthmodel.org/ ↩︎
- https://www.dyrias.com/en/ ↩︎
- Kersten, J., Burman, M., Houtsonen, J., Herbinger, P., & Leonhardmair, N. (Eds.). (2023). Domestic Violence and COVID-19: The 2020 Lockdown in the European Union. Springer. ↩︎
- https://eige.europa.eu/printpdf/news/eu-rights-and-equality-agency-heads-lets-step-our-efforts-end-domestic-violence ↩︎
- https://www.unwomen.de/aktuelles/corona-eine-krise-der-frauen.html ↩︎
- https://www.unwomen.de/fileadmin/user_upload/Corona/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf ↩︎
